Zu selten eine Hilfe?
Heerscharen von Defibrillatoren hängen in Supermärkten oder Sportklubs. Sie sollen Menschen vor dem plötzlichen Herztod retten. Selten genug gelingt das.

Veröffentlicht am 16. August 2016 - 09:21 Uhr,
aktualisiert am 7. September 2016 - 14:25 Uhr

Im Notfall sollte man zuerst mit der Herzmassage beginnen.
Zwei Drittel des Spiels hatte Felix Zahno gepfiffen, als er auf dem Eis zusammenbrach. Das haben ihm seine Retter erzählt, die Polizisten, die zum Plausch Hockey spielten, und der herbeigerufene Sanitäter.
Zahno kann sich erinnern, wie er in der Eishalle in Düdingen im Freiburgischen die Schlittschuhe montierte, «aber de isch aus fiischter». Er wachte drei Tage später im Berner Inselspital auf. Ohne gebrochene Rippen, wie sie bei den kräftigen Herzmassagen eher die Regel sind als die Ausnahme. Ohne Verbrennungen durch den externen Defibrillator, der dem Herzen einen Funkenschlag verpasst mit einer Energie, dass man kurzzeitig einen Kochherd anwerfen könnte. Und ohne Ahnung, wie ihm geschehen war.
Er hatte mehrfach Glück. Der junge Polizist massierte ihm sofort kräftig das Herz. Ein weiterer Spieler holte den Laien-Defibrillator beim Eingang der Eishalle. Als die Ambulanz eintraf, schlug Zahnos Herz wieder. Und er hatte Glück, dass er ein Mann ist. Frauen überleben den Herzstillstand deutlich seltener. Das mag mit der Scheu zu tun haben, einer leblos am Boden liegenden Frau die Bluse zu öffnen und den Büstenhalter durchzuschneiden, was für die Herzmassage und das Aufkleben der Kompressen für den Elektroschock nötig wäre.
«Wer nichts tut, riskiert, dass ein Mensch stirbt»
Bis zu 10'000 Menschen sterben in der Schweiz pro Jahr an plötzlichem Herztod. Ein Drittel könnte gerettet werden, sagt der Notfallmediziner Urs Wiget. Aber kaum jemand weiss, wie.
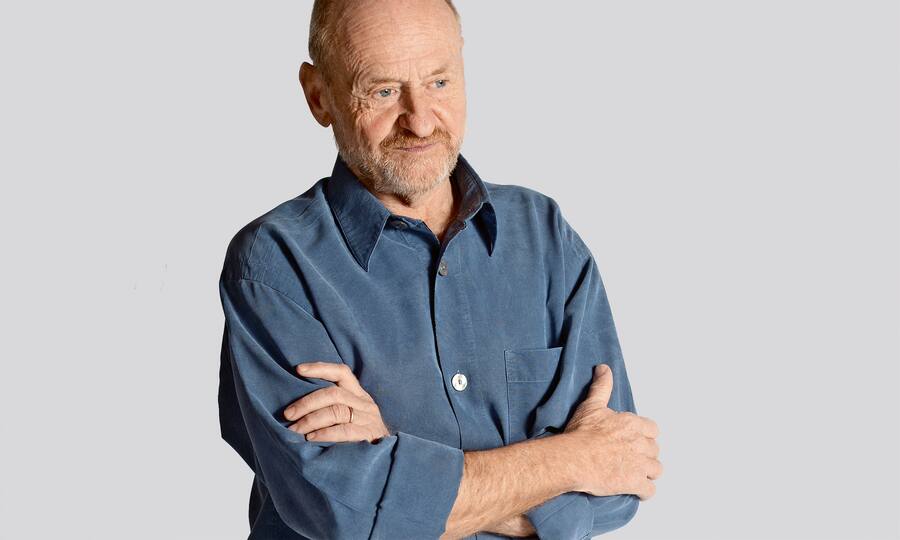
Da nach drei Minuten ohne Blutzirkulation ein bleibender Hirnschaden entsteht, ist die erfolgreiche Reanimation nach fünf Minuten in der Regel unmöglich; ein Laien-Defibrillator benötigt etwa zwei Minuten, um sich selbst zu erklären. «Es ist besser, mit der Herzmassage zu beginnen. Der Defibrillator ist ein wichtiges Element, aber nicht die erste Aktion», sagt Kardiologe Remo Osterwalder, Vizepräsident des Berufsverbands der Schweizer Ärzte FMH.
Die Hemmschwelle, eines der landesweit 25'000 bis 30'000 Schockgeräte aus dem Kästchen zu klauben, ist sehr hoch. Am Flughafen Zürich mit seinen Millionen von Besuchern wurde im laufenden Jahr dreimal ein Schockgerät eingesetzt, Resultat unbekannt. An der belebten Zürcher Bahnhofstrasse sieben Jahre lang gar nie, weshalb man die 13 Geräte wieder abmontierte.
Oft funktionieren die Defibrillatoren im entscheidenden Moment nicht. In den USA zeigte jedes fünfte Gerät eine Fehlermeldung an, liess sich nicht mehr aufladen und versagte.
In der Schweiz legte sich die Elektrobranche vor 20 Jahren erste Defibrillatoren zu. Sie brachten das Herz des Stromers nach dem elektrischen Schlag wieder auf Touren. Dann begann das Geschäft mit der diffusen Angst, jeder könnte jederzeit umfallen. Marktführer Procamed schaltet gar teure Werbung im Schweizer Fernsehen und will aus jedem Schweizer einen Lebensretter machen.
Gemeindebehörden wurden aufgefordert, mehr Defibrillatoren zu kaufen, Firmenbosse fühlten sich schuldig, wenn sie die 2000 bis 3000 Franken für das Blitzgerät sparen wollten und die kostspielige Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu Ersthelfern hinzu.
Folgerichtig empfängt neben dem Pfarrer ein froschgrünes Kästchen die Gläubigen in der Kirche St. Johann in Schaffhausen. Im Hotel Meielisalp in Leissigen am Thunersee erfragt man das Gerät an der Réception, und Tessiner Bordellbesitzer legten sich Schocker zu, nachdem ein Freier die Welt so verlassen hatte, wie er sie betreten hatte. Nackt. Künftig sollen gar die Züge durch den Gotthard mit Defibrillatoren bestückt werden. Ob je einer ausgepackt wird, ist fraglich.
«Bei uns erleben maximal zehn Prozent der Patienten den Spitaleintritt. Das ist unbefriedigend.»
Philipp Boschung, Sanitäter
Ein Rettungsprofi schätzt, dass von 100 Reanimierten vielleicht fünf die folgenden sechs Monate überleben. Die vielen anderen sterben an der schweren Schädigung des Hirns oder des Herzmuskels. In den über 20 Jahren, in denen der Profi gerufen wurde, hätten Laien den Defibrillator bloss an zwei Leblosen eingesetzt. Zudem breche man dem Patienten bei der kräftigen Herzmassage oft ein paar Rippen und/oder das Brustbein, dann gehe es «wesentlich leichter».
«Bei uns erleben maximal zehn Prozent der Patienten den Spitaleintritt. Das ist unbefriedigend», sagt Zahnos Sanitäter Philipp Boschung. Von den wenigen, die es ins Spital schaffen, sterben viele im Lift oder später auf der Intensivstation.
Bei manchen, die nach ein paar Tagen noch atmen, sind Herz und Hirn unwiederbringlich geschädigt. Auf sie wartet ein Pflegeheim. Sie sterben dort nach Jahren, mehr oder minder komatös, unfähig, zu sprechen, sich zu versorgen oder ihre Angehörigen zu erkennen, und ohne Aussicht auf Besserung. Diese Unglücklichen zählen, ohne dass sie es wissen, zu den Teuersten im Gesundheitswesen.
«Patienten in vegetativem Zustand nach Reanimation sind sehr selten», relativiert Martin Brüesch, Leiter der Gruppe für Notfallmedizin am Unispital Zürich. «Die meisten Patienten, die das Spital verlassen, sind in gutem neurologischem Zustand, das heisst, sie können ihrer früheren Tätigkeit wieder nachgehen und sind selbständig. Wenn die neurologischen Untersuchungen in der ersten Phase eine schlechte Prognose ergeben, wird die Therapie mit Einverständnis der Angehörigen eingestellt und auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet.»
Für Verheiratete können die Kosten zum Problem werden. Wie bei anderen Pflegefällen langt der Staat beim privaten Vermögen der Partner zu. In gewissen Fällen hilft nur eine Scheidung, allerdings sind die rechtlichen Hürden hoch. Man kann sich vorstellen, was in jemandem vorgeht, der eine so bittere Entscheidung treffen muss.
Die Statistiken erfassen ausschliesslich Patienten, bei denen es sinnvoll war, sie ins Leben zurückzuholen. Stellen die Sanitäter erste Todeszeichen fest, verzichten sie auf die Wiederbelebung. Profis verwenden keine Geräte wie die, die bei der Feuerwehr oder im Gemeindehaus hängen. Bei Grenzfällen wie der hochbetagten Patientin oder dem Mann mit drei Bypässen sei die Rettung «ein Dauerthema» in seinem Team, sagt ein erfahrener Sanitäter. Man frage sich: «Was produzieren wir denn da?»
Felix Zahno durfte acht Wochen nach dem Herzstillstand heim. Nach sechs Monaten voller Therapien und Tests geht es dem heute 66-Jährigen «ordeli». Er sagt, er vergesse viel mehr als früher, aber er sei zufrieden. Auf dem Eis war der leidenschaftliche Schiri nie mehr. Der Aussetzer hat es ihm verleidet.

9 Kommentare