Auch Sterbende haben ein Recht auf Schönes
Die Auswahl an Dingen, die man werdenden Eltern ins Spital mitbringen kann, ist riesig. Für todkranke Patienten gibt es dagegen kaum etwas. Designerin Bitten Stetter über die Gründe und womit sie Sterbenden die verbleibende Zeit verschönern will.
Beobachter: Frau Stetter, Produkte im Spital sind uniform, zweckorientiert, stapelbar. Sie möchten das ändern. Weshalb?
Bitten Stetter: Wer sehr krank ist, im Sterben liegt, wird zunehmend seiner Autonomie beraubt – und zwar auch bei unnötigen Dingen. Plötzlich ist der Nachttisch nicht mehr ein Aufbewahrungsort für persönliche Gegenstände, sondern für Pflegeutensilien des Gesundheitspersonals. Plötzlich tragen alle Patienten dieselben Krankenhemden, bei denen der Hintern beim Gehen hervorblitzt. Plötzlich haben Individualität, Schönheit und Ästhetik keinen Platz mehr. Alles ist nur noch praktisch und einheitlich.
Haben todkranke Patientinnen und Patienten nicht grössere Sorgen als unästhetisches Design?
Selbstverständlich haben sie das. Aber man darf nicht vergessen, dass Kranksein und Sterben langwierige Prozesse sein können. Man geht ins Spital, in die Reha, vielleicht wieder nach Hause, zurück ins Spital, ins Hospiz. Natürlich ist die Person in dieser Zeit Patient, aber sie ist auch immer noch ein Mensch, der ein Recht auf Wertschätzung und Lebensqualität hat. Wertige Materialien, persönliche Habseligkeiten, nützliche Hilfsmittel werden beim Eintritt ins Spital nicht plötzlich unwichtig. Im Gegenteil, vielleicht sind es gerade in solchen Situationen die kleinen Dinge, die uns Halt geben und das Gefühl von Normalität und Sicherheit vermitteln.
Die Idee zu Ihrem Designforschungsprojekt «Sterbedinge» kam Ihnen, weil Ihre eigene Mutter gegen den Krebs kämpfte. Welche Dinge fehlten ihr damals?
In der letzten Lebensphase ist die Welt meiner Mutter auf wenige Quadratmeter geschrumpft. In ihrem Bett bewahrte sie alles auf, was sie brauchte, um sich sicher zu fühlen; ihre Brille etwa, ihren Notizblock, ihren Stift. Diese Sachen verschwanden aber immer wieder, weil die Pflegenden sie bei ihren Alltagsverrichtungen aus dem Bett räumen mussten. Plötzlich gabs keinen Ort mehr, an dem meine Mutter ihre persönlichen Dinge aufbewahren konnte. Das beobachtete ich übrigens auch während meiner Designforschung im Rahmen des Projekts «Sterbesettings» des Schweizer Nationalfonds. Oft entstehen so kleine oder grosse Krisen.
«Der Tod wird eben noch immer als Niederlage der Medizin verstanden und – anders als die Geburtsabteilung – nicht als Teil des Ganzen gesehen und gestaltet.»
Bitten Stetter, Designerin
Wie haben Sie Ihrer Mutter geholfen?
Ich habe ihr einen Velokorb besorgt und ans Bett gehängt. Sie glauben gar nicht, wie viel Ruhe das in ihren Alltag brachte. Endlich gabs wieder einen festen Platz für ihre Sachen. Eines Tages bat mich meine Mutter, ihr ein schönes Nachthemd zu besorgen. Sie wollte trotz ihrer Krankheit nicht in diesem unsäglichen Patientenhemd im Bett liegen, wenn Familie oder Freunde sie besuchten.
Haben Sie etwas gefunden?
Ein Pflegehemd hat bestimmte funktionale Kriterien zu erfüllen. Es muss beispielsweise grosse Ärmel haben und sich hinten einfach öffnen lassen. Ich fand nichts Passendes. Darum kaufte ich ein Big Shirt und nähte es selbst um. Aus diesem improvisierten Teil und weiteren Beobachtungen während meiner Mitarbeit auf einer Palliativstation ist mittlerweile ein Mantel entstanden, den man vorne oder hinten offen tragen und mit einem Bändel verschliessen kann. Der weiche Stoff ist weit geschnitten, sodass er, um den Körper gewickelt, sämtliche intimen Stellen bedeckt. Ich habe das Stück Travel Wear genannt, Reisekleidung.
Das ist etwas zynisch, finden Sie nicht?
Überhaupt nicht. Das Leben ist eine Reise, die mit dem Tod endet. Ich finde die Bezeichnung deshalb passend. Mittlerweile beschäftige ich mich seit einigen Jahren mit diesem Thema und habe in dieser Zeit mit vielen Betroffenen und Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, aber auch mit Einzelhändlern gesprochen. Einer sagte einmal: Schöne Idee, aber ich kann meine Kunden nicht mit dem Lebensende konfrontieren. Genau das ist das Problem. Der Tod passiert weit weg von uns in Spitälern und Hospizen. Wir wissen nicht mehr, was am Lebensende geschieht, und somit sehen wir auch nicht, wie wir diesen Teil des Lebens gestalten können. Das ist für mich unverständlich. Warum können werdende Eltern vor der Geburt ihres Kindes so viele Dinge kaufen, aber wenn es um die Vorbereitung aufs Sterben geht, gibt es kaum etwas?
Haben Sie eine Vermutung?
Einerseits ist Sterben immer noch ein Tabuthema. Man will die Endlichkeit des Seins nicht an sich ranlassen. In den Spitälern und Hospizen ist es anders. Die Menschen da wissen sehr genau über den Sterbeprozess Bescheid. Aber auch dort möchte man das Thema am liebsten tabuisieren, schliesslich gehts in Spitälern darum, Menschen gesund nach Hause zu entlassen. Der Tod wird eben noch immer als Niederlage der Medizin verstanden und – anders als die Geburtsabteilung – nicht als Teil des Ganzen gesehen und gestaltet.
«Wer vor einer Geburt steht, kann in unzähligen Magazinen Tipps lesen, was man ins Spital mitbringen sollte. Ich habe aber selten einen Beitrag darüber gelesen, was man einer sterbenden Person ins Spital mitbringen sollte.»
Bitten Stetter, Designerin
Welche Gegenstände helfen dabei, diesen Augenblick zu gestalten?
Während meine Mutter im Sterben lag, fehlte es an so vielem. Deshalb habe ich begonnen, zu diesem Thema zu forschen und zu gestalten. So sind seither verschiedene Produkte entstanden, wie eine Bettbox, die Patienten an das Bett hängen und worin sie ihre persönlichen Gegenstände verstauen können – quasi die Weiterentwicklung des Velokorbs. Ich habe aber auch einen kleinen Behälter fürs Handy entwickelt, der sich am Triangel mit dem Alarmknopf über dem Bett befestigen lässt, sowie verschiedene Bilderständer für Fotos oder Behältnisse für elektrische Teelichter oder Aromen.
Was sollen diese Gadgets den Sterbenden bringen?
Sicherheit. Sicherheit, dass das, was mit ihnen passiert, normal ist, ihre Bedürfnisse normal sind, sie mit ihren Empfindungen nicht allein sind. Sterben ist zwar individuell, aber genauso wie bei einer Geburt gibt es auch Dinge, die sich wiederholen. Als meine Mutter krank war, wussten mein Bruder und ich nie, was davon ein normaler Teil des Prozesses und was der Ausnahmezustand war. Wer vor einer Geburt steht, kann in unzähligen Magazinen Tipps lesen, was man ins Spital mitbringen sollte. Ich habe aber selten einen Beitrag darüber gelesen, was man einer sterbenden Person ins Spital mitbringen sollte. Mit meiner Arbeit hoffe ich, ein Umdenken anzustossen. Ich möchte, dass die Menschen das Sterben als Teil des Lebens begreifen und sich frei fühlen, diesen Teil genau so zu gestalten, wie sie jeden anderen Lebensabschnitt individuell gestalten.
Zur Person

Die Designerin Bitten Stetter ist Professorin im Fachbereich Trends & Identity an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2015 widmet sie sich dem Thema Tod und Design, unter anderem im Rahmen des interdisziplinären Projekts Sterbesettings des Schweizerischen Nationalfonds.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

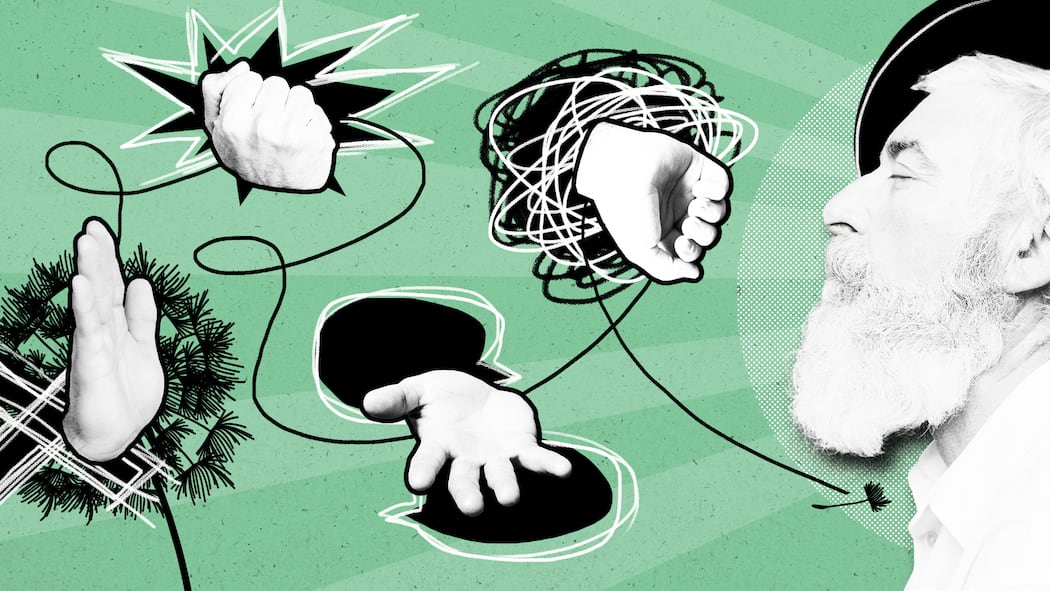





2 Kommentare
Das Einzige, was sicher ist im Leben, ist das Sterben und der Tod.
Niemand weiss im Voraus genau, wann und wie sie/er genau sterben wird.
Jeder Mensch, welcher sukzessive stirbt - Zeit erhält dazu -, hat das Recht auf Selbstbestimmung der Art und Weise des Sterbeprozesses. Das muss unbedingt akzeptiert werden.
Es gibt Menschen, welche im Sterbeprozess begleitet werden möchten, andere aber nicht.
Es kann deshalb hilfreich sein, sich beizeiten mit Krankheit, Sterben und Tod auseinanderzusetzen.
Prioritäten-Setzung im Schweizer "Gesundheits-Wesen" - alles zum ganzheitlichen Wohl von Menschen/Patienten,-Klienten,-BewohnerInnen???
Priorität hat beschämenderweise auch weiterhin - GELD, Profit - in den meisten Institutionen, nicht das ganzheitliche Wohl der Menschen!
NICHT aber wie oftmals so schön und harmonisch beschrieben in entsprechenden Unterlagen von: Spitälern, Kliniken, Heimen...der "Mensch" im Mittelpunkt = "Papier ist weiterhin geduldig"!!
Und das hat selbstverständlich auch mit den absolut notwendigen,weiterhin schweizweiten, immer noch NICHT eingeführten, offiziellen "Eignungs-Tests" (Charakter, Persönlichkeit, Empathie, Sprache, Umgangsformen) für sämtliches Personal(Ärzteschaft, SpezialistenInnen, Pflegepersonal, TherapeutenInnen,....im "gesamten" Schweizer: "Gesundheits-Wesen"