Darum gehts beim Stromgesetz
Am 9. Juni 2024 stimmt die Schweiz ab über das Gesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Die 12 wichtigsten Fakten dazu.

Veröffentlicht am 21. Mai 2024 - 08:47 Uhr
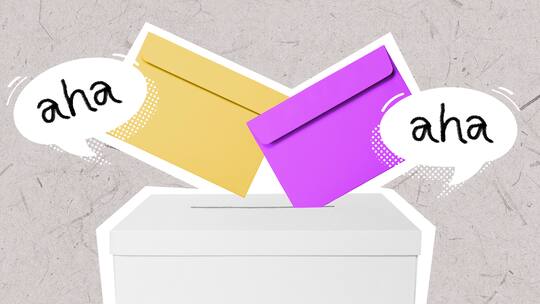
1. Wie ist die Ausgangslage?
Die Schweizer Stimmberechtigten haben 2017 entschieden, in erneuerbare Energien zu investieren und auf neue Atomkraftwerke zu verzichten – mit ihrem Ja zur Energiestrategie 2050. Seither ist viel passiert. Ganz Europa baut die Stromversorgung um. Zudem ist es durch internationale Konflikte wie den Krieg in der Ukraine schwieriger geworden, unser Land ständig mit genügend Energie zu versorgen. Gerade im Winter könnte es zu Engpässen kommen, wenn nicht genügend Strom aus dem Ausland importiert werden kann.
Hinzu kommt, dass die Schweiz in Zukunft generell mehr Strom benötigt. Denn um das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen zu erreichen, braucht es unter anderem die umfassende Elektrifizierung im Verkehrs- und Wärmesektor, etwa durch Elektroautos und Wärmepumpen. Deshalb muss die inländische Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen ausgebaut werden. Die Schweiz muss bis 2050 eine Stromlücke von mindestens 37 Terawattstunden (TWh) schliessen, mehr als die Hälfte davon im Winter – davon geht der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen in einer Studie aus. Es mangelt zwar nicht an Projekten, doch das heutige Ausbautempo reicht bei weitem nicht.
2. Was will das neue Stromgesetz?
Das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, wie die Vorlage offiziell heisst, will diesen Prozess beschleunigen. Also die Grundlagen dafür schaffen, dass in der Schweiz rasch – nämlich schon in den nächsten 10 bis 15 Jahren – deutlich mehr inländischer Strom aus den Energiequellen Wasser, Sonne, Wind oder Biomasse erzeugt werden kann. Das Ziel: eine eigenständige Stromversorgung, die vom Ausland – so weit möglich – unabhängig ist.
Die im Gesetz formulierten Ausbauziele sind ehrgeizig. So sollen die erneuerbaren Energien (ohne Wasserkraft) bis ins Jahr 2035 bereits 35 Terawattstunden Strom pro Jahr liefern; aktuell sind es erst rund 5 TWh. Die Wasserkraftanlagen sollen ihre Produktion bis 2035 auf 37,9 TWh steigern (heute 35,7). Zum Vergleich: Alle Schweizer Kernkraftwerke produzieren im Jahr rund 22 Terawattstunden Strom. 2022 hat die Schweiz insgesamt 57 Terawattstunden Strom verbraucht.
3. Weshalb stimmen wir darüber ab?
Das Gesetz wurde im Herbst 2023 vom Parlament verabschiedet: Im Nationalrat mit 177 Ja- gegen 19 Neinstimmen, im Ständerat sogar einstimmig. Umweltschutzkreise ergriffen das Referendum gegen den Beschluss: Die vorgesehenen Massnahmen würden zu einer übermässigen Belastung von Landschaft und Natur führen, so die Argumentation. Deshalb kommt die Vorlage am 9. Juni 2024 vors Volk.
4. Die Vorlage heisst auch «Mantelerlass Energie» – was bedeutet das?
Wenn zwischen einzelnen Änderungen in mehreren Gesetzen oder Verordnungen ein enger sachlicher Zusammenhang besteht, können diese Erlasse zur Vereinfachung zusammengefasst werden – eben in einem Mantelerlass. Diese Ausnahmeregel kommt hier zum Zug.
5. Welche Massnahmen sieht das Gesetz vor?
Die Ausbauziele sollen durch ein Bündel an Massnahmen erreicht werden. Die Vorlage umfasst Förderinstrumente (unter anderem werden Fördergelder länger ausbezahlt) sowie neue Regelungen für Produktion, Transport, Speicherung und Verbrauch von Strom. Namentlich sollen die Bewilligungsverfahren für neue Anlagen erleichtert und dadurch deren Bau beschleunigt werden. Ausserdem enthält die Vorlage Sparziele für den Energie- und Stromverbrauch.
6. Welche Rolle spielt die Wasserkraft für die künftige Stromversorgung?
Schon bisher stammt mehr als die Hälfte des in der Schweiz benötigten Stroms aus der Wasserkraft. Ihre Rolle bleibt zentral: Wenn die Vorlage angenommen wird, werden 16 Wasserkraftprojekte direkt ins Gesetz geschrieben. Davon sind jedoch nur drei neu. Bei den restlichen 13 Projekten sollen bestehende Anlagen vergrössert werden, etwa durch höhere Staumauern. Für alle 16 Vorhaben müssen Ausgleichsmassnahmen für Natur und Landschaft umgesetzt werden.
7. Und die Solarenergie?
Solarpanels sind der wichtigste Teil des Energieausbaus. Das neue Gesetz setzt zusätzliche Anreize für die Installation von Photovoltaik auf Gebäuden. Das Potenzial für weitere Anlagen auf Dächern und an Fassaden ist riesig, wird aber erst zu einem geringen Anteil genutzt. Nachteil: Im Winter produzieren diese Kleinanlagen deutlich weniger Strom. Deshalb sind ergänzend grosse Anlagen vorgesehen, die vor allem in alpinen Gebieten für mehr Winterstrom sorgen sollen. Wegen der Eingriffe in die Landschaft sind diese Projekte – wie auch Windkraftanlagen – häufig umstritten.
8. Wie steht es mit den Mitspracherechten?
Die Vorlage wahrt die demokratischen Mitsprachemöglichkeiten der Bevölkerung – über konkrete Projekte für Wind- oder Solarparks kann weiterhin auf Gemeinde- und Kantonsebene abgestimmt werden. Auch Einsprachen und Beschwerden sind unverändert zulässig.
Eine gewisse Einschränkung gibt es nur bei den 16 im Gesetz genannten Wasserkraftprojekten. Bei diesen fällt die Nutzungsplanung weg, für die in der Regel die Standortgemeinde zuständig ist. Damit entfällt hier auch die Möglichkeit, Rechtsmittel zu ergreifen. Massgebend für die Realisierung von Projekten ist jedoch das Konzessionsverfahren. Und dieses wird nicht tangiert: Wo das Stimmvolk über eine Konzessionsvergabe entscheidet, geschieht das weiterhin.
9. Betrifft die Vorlage auch die AKW-Frage?
Nein. Die wieder aufgeflammte politische Diskussion um die Zukunft der Atomkraft in der Schweiz hat keinen direkten Zusammenhang mit dem Mantelerlass Energie. In diesem Gesetz geht es nur um die erneuerbaren Energien.
10. Wie steht es mit den Kosten?
Damit mehr gebaut wird, werden die bestehenden Fördermittel verlängert. Finanziert werden sie – wie schon heute – mit dem Netzzuschlag. Dieser bleibt unverändert bei 2,3 Rappen pro verbrauchter Kilowattstunde. Somit entstehen gemäss dem Bundesamt für Energie durch die Vorlage keine zusätzlichen direkten Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
Es gibt aber auch andere Stimmen. So befürchten etwa die Aargauer Stromversorger, man würde durch das enge Regelwerk bei der Strombeschaffung künftig eingeschränkt, was zu höheren Preisen im Endverbrauch führen könne.
11. Wer ist für die Vorlage, wer dagegen?
Bundesrat, National- und Ständerat sowie die meisten Parteien machen sich für ein Ja zum Stromgesetz stark. Auch die grossen Umweltverbände wie WWF, Greenpeace, die Schweizerische Energiestiftung oder Pro Natura unterstützen den Mantelerlass. In einer Gesamtbeurteilung kommen sie zum Schluss, dass die Vorteile für die angestrebte Energiewende überwiegen und auch den Interessen des Umweltschutzes genügend Beachtung geschenkt wird. Zur breiten Allianz der Befürworter gehören auch die Strombranche sowie Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse oder Swisscleantech.
Dagegen sind die Fondation Franz Weber, der Verein Freie Landschaft Schweiz sowie Einzelpersonen. Sie haben das Referendum ergriffen und sich zu einem Nein-Komitee zusammengeschlossen. Sie kritisieren, dass der Mantelerlass überhastet beschlossen worden sei und zu unverhältnismässig starken Eingriffen in die Natur führe.
Zu den Gegnern der Vorlage gehört auch die SVP, die sich damit gegen ihren eigenen Bundesrat und Energieminister Albert Rösti stellt. Solar- und Windkraft würden keine sichere Stromversorgung garantieren, so eine Argumentation. Kritisiert wird auch, die Landschaft würde übermässig bebaut. Ferner werden Einbussen bei der Gemeindeautonomie befürchtet. Allerdings sind die Reihen der SVP nicht geschlossen. So haben etwa die Kantonalparteien Bern und St. Gallen die Ja-Parole beschlossen.
12. Wie geht es nach der Abstimmung weiter?
Das hohe Tempo bleibt: Wenn das neue Stromgesetz am 9. Juni an der Urne durchkommt, dürfte es bereits am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Bei einem Nein bleiben die bestehenden Gesetze wirksam. Einzelne Fördermassnahmen könnten jedoch auslaufen.

4 Kommentare
Erneuerbare Energie: Der Schutz wird marginalisiert!
Biodiversität, Natur-, Landschafts-, Heimat-, Ortbild- und Denkmalschutz werden in der Schweiz in Anbetracht eines angeblichen Energie- und Klimanotstands marginalisiert. So wie der Schweiz die Eidgenoss:innen sukzessive ausgehen, so verschwindet auch langsam deren Werteordnung.
Ich lese: „ über konkrete Projekte für Wind- oder Solarparks kann weiterhin auf Gemeinde- und Kantonsebene abgestimmt werden.“
Art.12 neues Energiegesetz: „Das nationale Interesse geht entgegenstehenden Interessen von kantonaler, regionaler, oder lokaler Bedeutung vor.“ !!!
Das steht doch im Widerspruch zu obigem Artikel? Oder nicht?
NEIN zum neuen Stromgesetz: Es garantiert keine sichere, keine zuverlässige und keine kostengünstige Energie.
Mittlerweile merken immer mehr, wie unsere Energiepolitik auf tönernen Füssen steht. Denn sie setzt stark auf «Zauberenergie» in Form von Flatterstrom durch Wind und Sonne. Probleme mit den Windrädern haben wir – abgesehen vom Landschaftsschutz – nicht dann, wenn sie sich drehen. Sondern dann, wenn sie nicht laufen und damit keinen Strom produzieren. Der elektrische Strom muss permanent verfügbar sein, denken wir nur an industrielle Prozesse, an die Rechenzentren oder an die Notfallstationen der Spitäler.
Darum braucht es für jedes Windkraftwerk noch ein anderes Kraftwerk, das zuverlässig Strom liefert. Oder Speicherseen beziehungsweise riesige Batterien, die es noch gar nicht gibt. Mit den Sonnenkollektoren ist es ähnlich.
NEIN zum Stromgesetz: Demokratie wird ausgeschaltet!
Je nach Ausgestaltung der kantonalen Rechtsvorschriften können die Kantone die Durchsetzung ihrer Energiepläne schrittweise über den kantonalen Richtplan und Verordnungen der Kantonsregierung an den Standortgemeinden und ihrer Bevölkerung vorbei manövrieren. Das sind letztlich undemokratische Tricksereien!