«Im Fussball geht es darum, einem Stamm anzugehören»
Was fesselt uns am Fussball? Warum steckt ein Stück Gewalt in ihm drin? Und wie wird der Frauenfussball ihn verändern? Der Kölner Fussballforscher und ehemalige Jugendspieler Kristian Naglo gibt Antworten.
Beobachter: Herr Naglo, warum schauen Sie Fussball?
Kristian Naglo: Gute Frage. Begonnen habe ich mit vier, als mich mein Vater im Verein angemeldet hat. Ich habe mich also nicht selbst für den Fussball entschieden, sondern es wurde für mich entschieden. Seitdem aktualisiere ich diese Entscheidung aber stets neu, habe eine regelrechte Faszination für das Spiel und seine kulturelle Bedeutung entwickelt. Worin die genau besteht, frage ich mich immer wieder. Was ist das Besondere am Fussball? Was unterscheidet ihn von anderen Sportarten?
Ja bitte, was?
Zunächst natürlich das Spiel mit dem Fuss, was deutlich weniger Kontrolle mit sich bringt. Fussball bedeutet ausserdem direkten Körperkontakt, eins gegen eins, und man versucht, den Gegner oder die Gegnerin auf Distanz zu halten, indem man den Ball zirkuliert. Diese Form der Ballkontrolle immer weiter zu entwickeln, das fasziniert. Fussball ist also schwierig – und einfach zugleich. Alle verstehen die Regeln, das Spiel ist flüssig und wird im Vergleich selten unterbrochen. Darum eignet es sich auch so gut zum Zuschauen, im Stadion und im Fernsehen. Auch die Spielzeit – 90 Minuten – wie ein Film.
Muss man selber Fussball gespielt haben, um vom Fussball fasziniert zu sein?
Sicher nicht auf hohem Niveau. Aber es macht bestimmt einen Teil der Faszination aus, dass jeder und jede schon mal gegen einen Ball gekickt hat und weiss, wie sich das anfühlt. Bei Eishockey, Rugby oder Tennis ist das eher nicht so.
Warum weckt der Fussball solche übersteigerten Emotionen? Beim entscheidenden Goal flippen wir aus, wie wir das sonst im Leben nie tun. Ein Gefühl, das Nicht-Fussball-Fans gar nicht kennen.
Starke Gefühlsausbrüche gibt es auch in anderen Sportarten. Wenn sie im Fussball noch extremer sind, dann vielleicht, weil er sehr körperlich ist und dieses Gefühl auch den Zuschauern vermittelt. Egal ob im Stadion oder auf dem Bolzplatz, egal ob beim Männer-, Frauen- oder Kinderfussball, man sieht Körper, die direkt – oft unkontrolliert – miteinander kollidieren, die alles geben, um den Ball ins gegnerische Tor zu bringen. Das steckt körperlich an, auch weil die anderen um einen herum das Gleiche erleben, quasi mitleiden.
«Der Fussball bietet als eigene Welt eine gute Möglichkeit, sich eine Identität aufzubauen, die sich beliebig basteln lässt.»
Kristian Naglo, Fussballforscher
Sie sprechen die anderen Zuschauer an. Nirgendwo spielen sie eine so wichtige Rolle wie beim Fussball.
Sie sind eben nicht nur Zuschauer, sondern selbst Akteure, die den Event ausmachen. Fussball ohne Fans, das funktioniert nicht wirklich, wie man während der Pandemie gesehen hat. Beim Fussball geht es darum, einem Stamm anzugehören. Familie und Gegenfamilie könnte man sagen. In keinem anderen Sport sind die gegnerischen Fans so wichtig für das Ereignis. Schmähgesänge, Diskriminierungen, die bis hin zu ethnisch-nationalistischen Beschimpfungen führen können – diese verbale und körperliche Gewalt gibt es im Fussball wie in keinem anderen Sport. Das hat einerseits mit der eigentlich unangemessenen Bedeutung zu tun, die wir ihm geben. Dass wir ihn also viel zu wichtig machen. Andererseits aber auch mit seiner Geschichte.
Was meinen Sie damit?
Wie praktisch alle modernen Sportarten kam auch der Fussball im 19. Jahrhundert in England zur Welt. Er war aber nie ein Repräsentant des Empires wie zum Beispiel Rugby und Cricket. Diese Spiele sollten die männlichen, christlichen Werte der britischen Oberschicht und des Militärs in die unterdrückten Gebiete tragen, um die Menschen dort zu disziplinieren. Fussball hatte nie diesen Zweck. Er entwickelte sich ungelenkt über den Austausch von Studierenden, Kaufleuten, Lehrerinnen und Lehrern entlang der Wirtschaftsrouten. Darum hat er auch zuerst dort Fuss gefasst, wo es bedeutende Häfen gab. Liverpool, Bilbao, Rio de Janeiro. Und er wurde deshalb schnell zum Sport der Mittelschichten. Die Mittelschicht definiert sich ja unter anderem dadurch, sehr kompetitiv zu sein, nach oben zu streben. Das hat auf die Weiterentwicklung des Fussballs abgefärbt.
Inwiefern?
Schon nach kurzer Zeit wurde der Fussball als Rivalität zwischen Gruppen und Orten inszeniert. Liverpool gegen Everton oder Manchester, Stadtclub gegen Umland, Arbeiterverein gegen Nobelclub. Das Fernsehen überhöhte das später noch. Sendungen wie die «Sportschau» oder «Match of the Day» leben davon, dass diese Rivalitäten und deren Geschichten immer neu erzählt werden können. Die Spiele bekommen so eine riesige Bedeutung. El Clasico, das Duell zwischen dem kastilischen Hauptstadtclub Real Madrid und dem katalanischen FC Barcelona, ist in Spanien länger als ein ganzes Wochenende das dominierende Thema.
Was bindet die Fans an einen Club?
Der Fussball bietet als eigene Welt eine gute Möglichkeit, sich eine Identität aufzubauen, die sich beliebig basteln lässt. Das kann die Verbindung zu einem Ort sein, muss aber nicht. Eine Baslerin definiert sich unter Umständen als Baslerin durch ihr FC-Basel-Fan-Sein. Ich kann aber auch als Kölner zur weltweiten Gemeinschaft der Barcelona-Anhängerinnen und -Anhänger gehören. Fussball ist lokal und global zur gleichen Zeit, Facetten des globalen Profifussballs werden lokal umgedeutet und neu interpretiert: Die Hymne des FC Liverpool «You’ll never walk alone» wurde zunächst komponiert für ein Broadway-Musical und fand in den 1960ern dann Eingang in die Fussballstadien Englands als Popsong von Gerry and the Pacemakers. Die Liverpool-Fans machten das Lied zu ihrer Hymne und der Verein den Slogan zu seinem Motto. Das Lied wird aber mittlerweile überall auf der Welt von Fans vor Spielen gesungen, etwa in Dortmund oder Mainz.
Ich bin immer noch GC-Fan, obwohl der Club inzwischen einem chinesischen Konzern gehört, kein eigenes Stadion mehr hat, Spieler und Trainer dauernd wechseln und die Mannschaft seit Jahren schlecht spielt. Weshalb wechsle ich meinen Verein nicht?
Meist hat man schon zu viel zusammen erlebt, als dass man sich noch von ihm lösen könnte. Auch wenn das, was einmal der Grund für die Bindung war, vielleicht längst nicht mehr da ist. Wichtig ist aus meiner Sicht der Gedanke der Optimierung, der den Fussball prägt. Man hofft immer, dass es wieder besser wird. Aber auch die Krise bindet an den Verein: Man leidet, wird zur Schicksalsgemeinschaft. Wer diese Schicksalsgemeinschaft verlässt, wird als illoyal angesehen. Selbst FC-Zürich-Fans, die Ihre Bindung zu GC nicht verstehen, würden einen Wechsel zum FCZ wohl nicht gut finden. Leidensfähigkeit gehört für viele zum Fan-Sein dazu. Vielen sind darum FC-Bayern-Fans suspekt, weil die praktisch nur den Erfolg, nicht aber das Leid kennen.
«Der Fussball gilt bis heute als eine männliche Angelegenheit und wird von männlichen Verhaltensweisen dominiert. Da ist Gewalt – ob verbal, auf dem Platz oder neben dem Platz – nun mal ein Teil davon.»
Kristian Naglo, Fussballforscher
Ist Fussball eine Religion?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Seit den 50er- und 60er-Jahren ist er an vielen Orten an ihre Stelle getreten, gemeinsam mit der Verbreitung von Fernsehgeräten für den privaten Gebrauch, James-Bond-Filmen oder Popmusik. Der sonntägliche Stadionbesuch ersetzt dann den Messgang. Der Fussball hat viele religiöse Elemente: die Stadien als Kathedralen, die Gesänge, die immer gleichen Rituale. Man hält die Schals hoch oder klatscht, wenn die Spieler die Arena betreten, man singt die Vereinshymne, man nimmt seit Jahren oder gar Jahrzehnten einen bestimmten Platz im Stadion ein.
Immer wieder hört man auch: Der Fussball stehe für bestimmte Werte.
Ja. Der Fussball beschwört immer wieder Werte wie Respekt, Toleranz oder Fair Play. Es heisst auch oft, der Fussball wirke verbindend. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass immer auch das Gegenteil zutrifft: Der Fussball wirkt genauso trennend, er vermittelt gerade auch im Jugendbereich übertriebenen Ehrgeiz, er steht ausserdem für offen ausgetragenen Sexismus und Rassismus sowie Homophobie.
Ist es nicht gut, wenn Verbände und Clubs sich gegen Diskriminierung stark machen, gegen Rassismus, gegen Homophobie?
Doch. Aber wenn man das als die Werte des Fussballs verkauft, ist es problematisch. Ausserhalb der Werbevideos findet diese propagierte Vielfalt und Toleranz im Fussball kaum statt, weder auf den Amateurplätzen noch in den grossen Stadien oder bei den Verbänden. Es ist doch eher so, dass beim Fussball gewisse zivilisatorische Regeln aufgehoben werden. Der Vater, der vor seinen Kindern hemmungslos den Schiedsrichter beschimpft – wo gibt es das sonst? Ich jedenfalls nehme das Stadion eher als einen anarchischen Ort wahr, wo aggressiver Lokalpatriotismus und Nationalismus und bis zu einem gewissen Grad auch Chauvinismus akzeptierter sind als anderswo, wo man Emotionen in alle Richtungen noch ungehemmt auslebt.
Zieht der Fussball Gewalt an oder schafft er Gewalt? Steckt Gewalt im Fussball drin?
Ich denke schon. Zum einen ist die direkte körperliche Auseinandersetzung allgegenwärtig. Vor allem ist Fussball aber ein Spiel mit männlicher Grammatik. Schwäche wird nicht akzeptiert. Das ist bereits im Kinderfussball so. Der Fussball gilt bis heute als eine männliche Angelegenheit und wird von männlichen Verhaltensweisen dominiert. Da ist Gewalt – ob verbal, auf dem Platz oder neben dem Platz – nun mal ein Teil davon. Zwar wurde Fussball seit Beginn der 1990er nach und nach zu einem Hochglanzprodukt entwickelt, die Hooligans aus den Stadien verbannt. Trotzdem ist das Gewaltpotenzial noch vorhanden.
Wenn das Männliche ein zentrales Element des Fussballs ist – was passiert, wenn jetzt der Frauenfussball dazukommt? Wird er den Fussball verändern?
Das ist ein spannendes Thema. Man hört oft: Im Frauenfussball werden noch Werte vermittelt, das ist noch richtiger Sport, da wird nicht simuliert, da gibt es keine Mätzchen, da ist man nett zueinander. Auch die Fans: keine übersteigerten Rivalitäten, nicht dieses Stammesdenken. Gleichzeitig wird der Fussball der Frauen von Männern organisiert und geleitet, Trainerinnen gibt es auf dem höchsten Liganiveau kaum. Ausserdem existieren keine eigenen Verbandsstrukturen für Frauen. In diesem Rahmen ist der Fussball der Frauen eher eine Parallelwelt oder ein Quasifussball, der nicht an das Original des Männerfussballs heranreicht. Ich glaube jedenfalls, dass es der Attraktivität des Frauenfussballs nicht zuträglich ist, wenn er als der bessere «Wertevermittler» verkauft wird.
Das heisst, der Frauenfussball muss wie Männerfussball werden, um Erfolg zu haben?
Einerseits ja. Andererseits muss er sich aber auch von Männerfussball abheben. Die meisten mehr oder weniger professionellen Frauenteams sind heute Bestandteil von Grossclubs, in denen sie mit den Jugendmannschaften der Männer um Geld, Trainingszeit und -plätze konkurrieren. Sie können in der Gunst des Publikums nicht mit den Teams der Männer mithalten, weil ihnen ganz einfach die Geschichte fehlt, die im Fussball so wichtig ist. Lange war der Fussball der Frauen ja gar nicht erlaubt, in Deutschland zum Beispiel zwischen 1955 und 1970. Diese eigene Identität, diese eigene Tradition muss sich nun erst entwickeln. Aber ich glaube nicht, dass das im Schatten von Männermannschaften funktioniert. Das Dilemma ist wohl: Der Fussball der Frauen muss sich auf allen Ebenen professionalisieren und kommerzialisieren, um konkurrenzfähig zu sein. Dann unterscheidet er sich aber nicht mehr vom Fussball der Männer und wird nur schwer eine eigene Anhängerschaft finden.
Kristian Naglo (49) wurde als Spieler mit der A-Jugendmannschaft des 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1990/1991 deutscher Vizemeister. Einen Profivertrag schloss er aber nie ab. Heute ist er Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er hat mehrere Bücher zur Fussballkultur herausgegeben. Nächstes Jahr erscheint von ihm «In Fussballwelten. Ethnografische Perspektiven auf soziale und sprachliche Räume im nichtprofessionellen Fussball.» Wiesbaden: Springer VS (Buchreihe «Erlebniswelten»). Zusammen mit seiner Familie lebt Naglo in Mainz und besucht mit seinem Sohn regelmässig Spiele des Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.

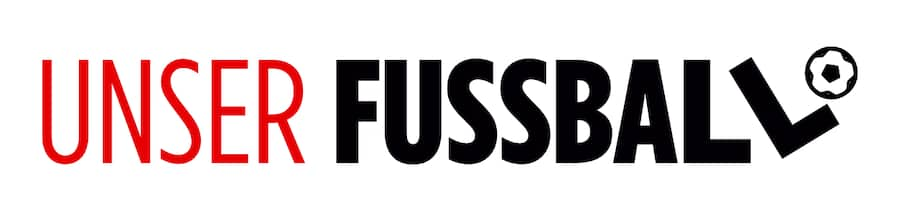
Die Weltmeisterschaft in Katar hat begonnen. Fussball ist aber mehr als Spitzensport und Big Business. Doch was ist er eigentlich? Der Beobachter hat sich umgesehen – und den Fussball in seiner ganzen Vielfalt angetroffen. Zum Beispiel an der Bergdorfmeisterschaft im Wallis und in den launigen Erzählungen der Reporterlegende Beni Thurnheer; unterwegs mit einem Groundhopper oder bei einem Juniorentrainer, der auch Sozialarbeiter und Ermutiger ist. Geschichten über den etwas anderen, den echten Fussball. Über die Gefühle, die er weckt, und die Menschen, die ihn ausmachen. Mit schönen Grüssen nach Katar: das Beobachter Spezial «Unser Fussball» inklusive Video, Audio und Wettbewerb.

