Für Studierende wirds ungemütlich: Sie sollen länger arbeiten
44 Jahre berufstätig sein, sonst gibt es keine volle Rente: Das fordert der Nationalrat. Wie soll das funktionieren? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Veröffentlicht am 5. Mai 2023 - 16:48 Uhr
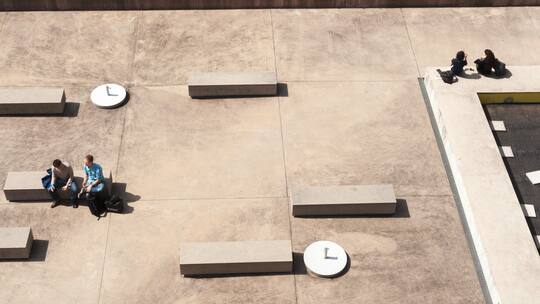
Studierende sitzen auf der Steinterrasse vor der Universität Zürich.
7 Fragen und Antworten zur Lebensarbeitszeit:
Worum geht es bei der Lebensarbeitszeit?
Anfang Mai hat der Nationalrat das Postulat zur «Lebensarbeitszeit» der Mitte-Partei angenommen. Die Partei glaubt, dass damit das Rentensystem fairer gestaltet und gleichzeitig die AHV stabilisiert werden kann. Statt einem fixen Pensionsalter sollen alle Personen 44 Jahre lang arbeiten, um Anspruch auf eine volle Rente zu erhalten. Personen, die erst später ins Berufsleben einsteigen, sollen demnach später pensioniert werden. Zum Beispiel Akademikerinnen und Akademiker.
Was sind die Vorteile des Modells?
Florian Schubiger von der Vorsorgeberatungsfirma Vermögenspartner AG ist unabhängiger Finanzexperte. Er findet das Lebensarbeitszeitmodell ein «effizientes und faires System». Personen mit hohem sozialem Status würden in der Regel eine längere Ausbildung geniessen, sagt er. Das würde durch die Kopplung des Rentenalters an die Beschäftigungsjahre berücksichtigt werden. Wer zum Beispiel erst mit 27 Jahren berufstätig wird, kann erst mit 71 Jahren in Rente. Wer hingegen schon mit 20 Jahren ins Berufsleben einsteigt, soll mit 64 Jahren vorzeitig pensioniert werden.
Was sind die Schwierigkeiten bei der Lebensarbeitszeit?
«Die Hauptfrage ist, wie die Erwerbsarbeit definiert wird. Viele Personen haben ein 80-Prozent-Pensum. Diese arbeiten am Ende etwa sechs Jahre weniger als jene mit einem 100-Prozent-Pensum», sagt Schubiger. Zudem seien auch viele Studierende erwerbstätig. Tatsächlich üben laut dem Bundesamt für Statistik drei von vier Studierenden einen Job aus. Das Teilzeitstudium ist ein beliebtes Modell für Studierende, die bereits fest im Berufsleben verankert sind. Eine weitere Frage sei, wie mit Selbständigen umgegangen werde, so Schubiger. «Die Kontrolle solcher Aspekte wird auf jeden Fall deutlich komplizierter sein als heute.»
Wieso genau 44 Jahre?
«Die 44 Jahre sind ein Zahlenbeispiel und entsprechen der aktuellen Arbeitszeit bis zur Pension nach einem Abschluss der Lehre oder eines Bachelors», sagt Schubiger. «Der Knackpunkt ist aber auch hier wieder die Definition der Erwerbstätigkeit. Abhängig davon braucht es eine Neuberechnung der Beitragsjahre. Ansonsten besteht Gefahr, dass ein Grossteil der Gesellschaft zukünftig länger arbeitet als heute.»
Wie geht es nun weiter mit dem Vorschlag zur Lebensarbeitszeit?
Die Mehrheit des Nationalrats hat den Vorschlag gutgeheissen. Über einen allfälligen Reformvorschlag des Bundesrats wird im Parlament aber nochmals diskutiert werden. Auch ein Referendum und somit eine Volksabstimmung ist wahrscheinlich.
Wann die Lebensarbeitszeit somit tatsächlich Realität wird, sei schwer zu sagen, sagt Schubiger. «Es wäre eine riesige Umstellung im System, die vielleicht in zehn Jahren, vielleicht auch später eintreten wird.» Das hänge davon ab, was der Bundesrat nun ausarbeiten würde. Dieser ist nun beauftragt, für die Periode von 2030 bis 2040 einen AHV-Stabilisierungsplan zu erarbeiten. Dabei soll speziell der Begriff der Erwerbstätigkeit nach Beschäftigungsgrad und Einkommen definiert werden. Auch die Dauer der Erwerbstätigkeit mit Unterbrüchen muss geregelt werden.
Was spricht gegen das Modell der Lebensarbeitszeit?
Gegen den Vorschlag der Mitte-Partei sind die SP und die Grünen. Das Hauptargument ist, dass nicht jede lange Ausbildungszeit automatisch zu einem Beruf mit guten Arbeitsbedingungen führe. Wer sich lange ausbilde und danach wenig verdiene, werde bestraft.
Was heisst das für mich konkret?
Sollte die Reform jemals zustandekommen, wird es noch Jahre dauern, bis sie in Kraft treten könnte. Ausserdem müsste es eine Übergangsfrist geben, denn: «Menschen, die jetzt studieren, wären von der Änderung betroffen», sagt Schubiger. Das sei schwierig, weil manche Personen nach dem jetzigen System eine Entscheidung über ihre Ausbildung getroffen hätten, die nach dem neuen System anders ausfallen könnte. Es bleibe abzuwarten, wie lang die Übergangszeit sein wird. Genaue Aussagen seien zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu treffen.

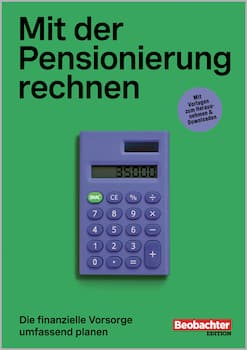
8 Kommentare
Was sind das für absurde Forderungen von einem Regierungsgremium, das seit Jahrzehnten kein Problem damit hat, dass …
1.) sich die Bundesrät nach wenigen Jahren Tätigkeit lebenslange Jahresrenten von über 200‘000 Fr. und ihren Partnerinnen lebenslange Witwenrenten von über 140‘000 Fr. gönnen, während …
2.) dieselben BR bei Normal- und Wenigverdienenden lebenslange Witwenrenten streichen und laufende Renten kürzen (Tagi,8.12.23), …
3.) sich aber mit kostenlosesen 1.Klass-GA, Geschäftsautos mit Chauffeur, schweizweiten Gratis-Skipässen bedienen und …
4.) dazu noch Boni und 3stellige Mio-Sonderboni den Bankenversagern und deren Nutzniesser zustecken und diese auch noch schuldfrei durchwinken (Tagi, 8.7./16.9.23) - während im Gegensatz dazu …
5.) Bürger als ü50 auf die Strasse gestellt werden (natürlich ohne automatische Rente und nach entwürdigendem Bettelgang mit etwas Arbeitslosen- und danach noch weniger Sozialgeld) und …
6.) sich Workingpoors nicht einmal ein Weihnachtsgeschenk für ihr Kind leisten können und …
7.) für Essen anstehen (watson, 20.12./16.10.23) -
bei SOLCHEN Zuständen finde ich die Forderung des Nationalrates Argumentation schlicht absurd:
Solange sich unsere BR und dessen Lobby-Günstlinge dermassen schamlos bedienen können, hat es auch Geld für Normal- und Wenigverdienende.
Was es allerdings tatsächlich zuwenig hat, sind PolitikerInnen, UnternehmerInnen und BürgerInnen mit einem Minimum an sozialem Mitverantwortungsbewusstsein.
Mehr als offensichtlich geht es der Bürgerlichenlobby einmal mehr um den Schutz ihrer rücksichtslosen Interessen und wenn dazu nötig ist, Nicht-Akademiker gegen Akademiker und Vollzeit- gegen Teilzeitarbeitende aufzuhetzen, ist offenbar auch dieses Mittel recht - einfach nur noch ekelhaft asozial bis in den Kern.
Studieren auf Kosten der Berufstätigen, dann mehr verdienen als nicht-Akademiker, und wegen des guten Verdienstes die Möglichkeit haben, Teilzeit zu arbeiten und/oder früher in Pension zu gehen?
Die Lebensarbeitszeit bringt mehr Gerechtigkeit.
Da gebe ich Ihnen Recht.
Voluntariate in Vereinen beispielsweise müssten auch berücksichtigt werden. Aber Ich denke, es geht einzig darum, den AHV und PK Töpfe zu schützen, in dem möglichst viele erst später zu Rentenbezügern werden.
Wann kommt endlich der Wandel von Arbeits- in eine Sinngesellschaft, den
die fortschreitende Automatisierung und KI ermöglichen. Und wann kehren wir vom Konsum ab?
Der Ansatz mag stimmen. Studierende arbeiten ja auch - nur ohne Bezahlung oder um das Studium zu finanzieren in "unterbezahlten" Ferien- und Wochenendjobs. Sinnvoller wäre der Ansatz: wer nur 80 % arbeitet soll nur 80% der Maximalrente erhalten. Dabei sollten auch "unbezahlte" Freiwilligenarbeit zugunsten der Allgemeinheit als auch Erziehungs- und Betreuungsarbeit berücksichtigt werden. Auch die Vermögensverhältnisse sollten berücksichtigt werden. Wer viel geerbt oder sein Vermögen durch Spekulation erworben hat, ohne dafür gearbeitet zu haben (denn Geld kann bekanntlich nicht arbeiten....) und damit einen angemessenen Lebensstandart finanzieren kann, soll keine Rente erhalten. Durch Arbeit ersparte Vermögenswerte sollen dabei unangetastet bleiben. Ich sehe dabei aber ein grundsätzliches Problem: wer viel hat der möchte wenig abgeben! Und wer ist alles im Parlament vertreten ?