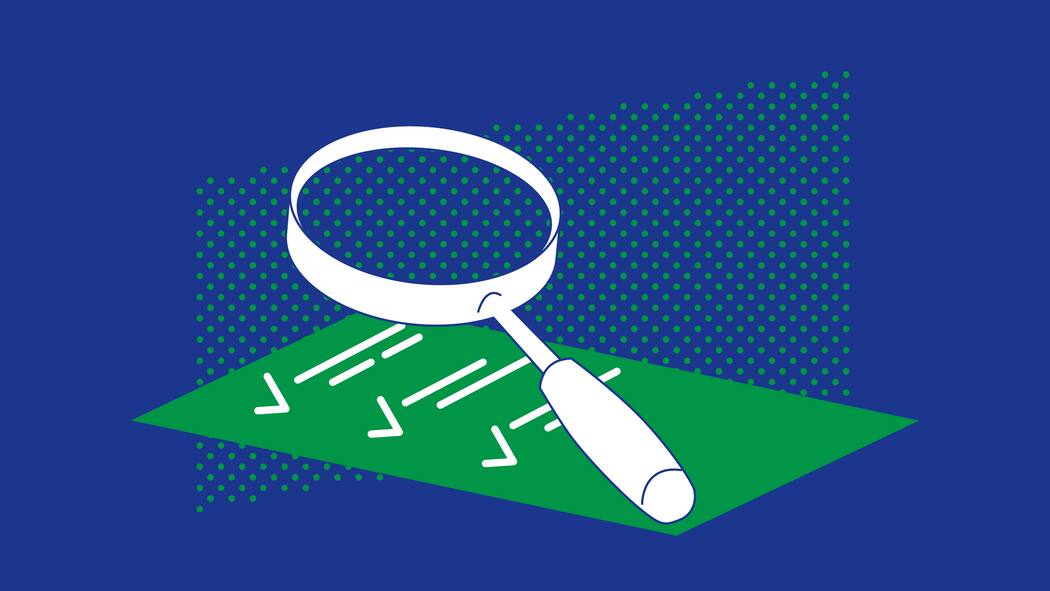Wie gehen wir um mit minderjährigen Straftätern?
Sprayen, Kiffen – oder Töten: Was gilt rechtlich für minderjährige Straftäter und Straftäterinnen – und warum? Der Beobachter hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Veröffentlicht am 15. Mai 2025 - 16:45 Uhr

Plüschtiere, Rosen und Kerzen an der Stelle nahe des Schützenhauses Berikon, wo am 11. Mai 2025 eine 15-Jährige getötet wurde – tatverdächtig ist ihre 14-jährige Freundin.
In Berikon ereignete sich letzten Sonntag ein tragischer Vorfall: Eine 15-Jährige verliert ihr Leben, mutmasslich durch die Hand ihrer besten Freundin, die sie erstochen haben soll. Das traurige Ereignis erschüttert das Land – und wirft Fragen zum Umgang mit Minderjährigen im Strafrecht auf.
Das Jugendstrafrecht beschäftigt aktuell nicht nur die Gemüter, sondern auch die Politik: Das Parlament hat im Juni 2024 beschlossen, das Jugendstrafgesetz zu ändern.
Junge Erwachsene, die zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr einen Mord begangen haben, sollen künftig mit Erreichen der Volljährigkeit verwahrt werden können. Zumindest, sofern eine ernsthafte Rückfallgefahr für einen Mord besteht. Die Neuerung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft.
Der Nationalrat will das Jugendstrafrecht zusätzlich verschärfen
Zudem hat der Nationalrat vor der Tat in Berikon einem Vorstoss zugestimmt, der das Jugendstrafrecht zusätzlich verschärfen will. Als Nächstes entscheidet der Ständerat darüber.
Zu Tötungsdelikten unter Jugendlichen kommt es zum Glück aber eher selten. Ein Blick auf die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigt: Wenn Jugendliche verurteilt werden, dann am ehesten, weil sie klauen, die Verkehrsregeln brechen, schwarzfahren oder gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen.
Ob ein junger Mensch nun einen harmlosen «Seich» macht oder mit roher Gewalt andere verletzt: Wie gehen wir mit jugendlichen Straftätern um? Welche Strafen und Massnahmen sieht das Gesetz vor? Und was ist bei jugendlichen Tätern und Täterinnen anders als bei Erwachsenen?
Ab 10 Jahre ist man strafmündig
Generell gilt in der Schweiz: Kinder können strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, sofern sie mindestens zehn Jahre alt sind. Dann sind sie «strafmündig». Das Jugendstrafrecht gilt bis zum 18. Lebensjahr.
Sein Ziel ist es, den Jugendlichen zu schützen und zu erziehen. Im Fokus ist nicht die Tat, sondern die Person. Die Entwicklung der Persönlichkeit steht also viel mehr im Zentrum als beim Erwachsenenstrafrecht.
Kein Strafrecht ohne Strafen
Wenn die jugendliche Täterin fähig ist, das Unrecht ihrer Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln, wird sie bestraft. Die leichteste Strafe ist ein Verweis. Das ist nichts anderes als eine schriftliche Missbilligung der Tat.
Die Strafe kann aber auch darin bestehen, einen Gratiseinsatz leisten zu müssen, etwa zugunsten einer sozialen Einrichtung.
Eine Busse oder eine Freiheitsstrafe gibt es allerdings nur für Jugendliche, die im Tatzeitpunkt schon mindestens 15 Jahre alt waren.
Auch Schutzmassnahmen möglich
Wenn Jugendliche eine besondere erzieherische Betreuung oder therapeutische Behandlung brauchen, wird eine Schutzmassnahme angeordnet.
Sie kann etwa darin bestehen, dass die Eltern in der Erziehung unterstützt werden und der Jugendliche persönlich betreut wird; oder in einer Therapie, etwa wenn die junge Täterin unter einer psychischen Störung oder Sucht leidet.
Was heisst das nun konkret?
Was in Berikon zwischen den beiden Mädchen genau passiert ist, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Strafbehörden ermitteln.
Fest steht: Da die mutmassliche Täterin noch keine 15 Jahre alt ist, ist mit einer Strafe von höchstens zehn Tagen Arbeitseinsatz zu rechnen. Denn für eine Busse oder für eine Freiheitsstrafe ist sie noch zu jung.
-
Gesetz: Jugendstrafgesetz
-
Bundesamt für Statistik: Jugendurteile
-
Bundesrat: Änderungen des Jugendstrafgesetzes per 1. Juli 2025
-
Nationalrat: Vorstoss zur Verschärfung des Jugendstrafrechts