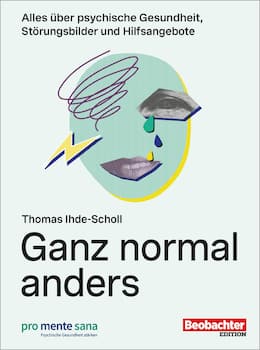«Das alles ist ein grosses Experiment für die Psyche»
Manche haben existenzielle Sorgen, andere leiden, weil sie nicht in die Ferien können. Müssen sie sich deswegen wirklich schämen? Über Schuld- und Schamgefühle in der Pandemie.

Veröffentlicht am 25. Mai 2021 - 17:00 Uhr

Erst wenige Wochen sind die Ausschreitungen in St. Gallen her. Die Junge zu den Hauptopfern der Pandemie zu erklären, sei falsch, hiess es anschliessend in manchen Medien.
Es ist nur eins von vielen Beispielen, in denen öffentlich darüber debattiert wird, wer nun Anrecht auf den Opferstatus und den damit verbundenen Frust hat:
- Sind es die Kinder und Jugendlichen, die nicht mehr zur Schule können?
- Dürfen sich die Senioren schlecht fühlen, die überdurchschnittlich häufig von den schweren Covid-19-Verläufen betroffen sind
- Dürfen die Eltern verzweifeln, die Homeoffice und Nachwuchs unter einen Hut bringen müssen?
- Dürfen sich jene beklagen, die ihren Job verloren haben und in eine finanzielle Notlage geraten sind?
- Darf man sich schlecht fühlen, weil man es vermisst, in die Ferien zu reisen, mit Freunden in eine Bar zu gehen, im Restaurant zu essen, durch Ausstellungen zu schlendern, Konzerte zu besuchen?
- Und wer muss sich schämen oder schuldig fühlen? Jene, welche die Sicherheitsregeln nicht einhalten, sich trotz Husten nicht testen lassen – oder auch jene, die den Slowdown geniessen?
Spontane extreme Gefühle sind normal
Die ganze Schweiz, ja die ganze Welt, diskutiert seit Monaten darüber, wer sich in diesen Zeiten schlecht fühlen darf und wer sich schuldig fühlen muss. Nicht ohne Folgen. Wortungetüme wie «Covid-Scham» und «Covid-Schuld» sind daraus entstanden. Ein Versuch, all die Emotionen, die eine Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen mit sich bringen, in Worte zu fassen.
«Egal, ob es nun die Frustration über die gestrichenen Sommerferien oder die Trauer über einen verstorbenen Angehörigen ist – spontane extreme Gefühle und Reaktionen auf schlechte Nachrichten sind nicht nur normal, sondern helfen dabei, wichtige Verarbeitungsmechanismen in Gang zu setzen», erklärt Andreas Maercker, Professor am Psychologischen Instituts der Universität Zürich. Dabei gehe es um eine aktive Auseinandersetzung mit der neuen Lage und der eigenen Frustration. «Ein Problem wird immer dann nicht verarbeitet, wenn man die Gefühle und Gedanken, die es auslöst, vermeidet und versucht, so weiterzumachen, als ob nichts passiert wäre.»
«Scham zeugt von grosser Empathie und der Fähigkeit, Mitleid für andere zu empfinden.»
Andreas Maercker, Psychologieprofessor
Zu verarbeiten haben wir in diesen Zeiten alle etwas. Trotzdem fühlen sich viele Menschen in diesen Zeiten gezwungen, auf die Frage «Wie gehts?» mit «Eigentlich schon gut, aber …» zu antworten. Die Scham darüber, sich schlecht zu fühlen, wenn es anderen doch viel schlechter ergeht, sei ein Signal dafür, dass man trotz der eigenen Situation den gesamtgesellschaftlichen Kontext weiterhin im Blick behalte. «Scham zeugt von grosser Empathie und der Fähigkeit, Mitleid für andere zu empfinden», weiss Andreas Maercker.
Der Vergleich mit jenen, die es noch schlechter haben, ist aber auch eine Möglichkeit, sich selbst besser zu fühlen. «Die sogenannte downward social comparison, also der Abwärtsvergleich, ist ein gängiges Mittel, um die eigene Stimmung zu heben», so der Psychologieprofessor weiter.
Soziale Medien bewirken auch Positives
Die Methode scheint auch in der Pandemie bestens zu funktionieren. Italienische Forscher haben letzten März und April eine Online-Umfrage durchgeführt, um das psychosoziale Stresslevel der Teilnehmenden zu erheben und herauszufinden, welche Rolle Soziale Medien bei der Milderung dieses psychologischen Zustands spielen. Die Ergebnisse zeigten – wenig überraschend – einen Anstieg von Einsamkeit, Depression, Stress und Angst sowie einen Rückgang der Lebenszufriedenheit.
Interessant ist aber, dass Soziale Medien offenbar nicht nur das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und emotionaler Unterstützung befriedigen, sondern auch nach sozialem Vergleich. Und sich dieser positiv auf die Befragten ausgewirkt und zu einer Reduktion des psychischen Stress’ während der Quarantäne geführt hat.
Die Überlebensschuld
Ein anderes Phänomen, das seit Covid-19 Hochkonjunktur hat, ist die Überlebensschuld. Der Begriff umschreibt die emotionale Belastung, die Menschen empfinden können, nachdem sie ein traumatisches Ereignis überlebt haben, bei dem andere ums Leben gekommen sind.
Während manche Menschen mit einer konventionellen Form von Überlebensschuld zu kämpfen haben, nachdem sie Covid-19 überstanden haben, hat sich auch eine neue Variante dieses Phänomens entwickelt. Und zwar bei jenen, die sich überhaupt nicht betroffen fühlen, gesund geblieben sind, weiterhin einen Job haben, Erfolge feiern, die Shutdowns vielleicht sogar genossen haben.
«Diese Schuld beim Sich-Wohlfühlen, wenn es anderen sehr schlecht geht, muss man nicht unbedingt gleich bekämpfen. Sie ist ein Ausweis eigener Empathie. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm oder unmoralisch, wenn man sich trotz alledem in der jetzigen Corona-Lage gut fühlt», erklärt Maercker.
Aggressivität, Ängstlichkeit und der Autopilot
Klar ist: Die Pandemie lässt niemanden unberührt, der Umgang damit variiert allerdings. «Während Jugendliche stark mit der Situation hadern, stellen wir bei ältere Menschen eine erhöhte Aggressivität und Ängstlichkeit fest», weiss Maercker. Die 30- bis 60-Jährigen würden sich solche Gefühle hingegen weniger stark erlauben und eher auf Autopilot schalten. Welcher Umgang mit der Pandemie psychologisch betrachtet am hilfreichsten ist, könne man heute noch nicht beurteilen.
«Die Kompensationsfähigkeit nach Krisen ist sehr gross. Es ist gut möglich, dass wir keine Spätfolgen davontragen. Sicher sein können wir uns allerdings nicht. Das alles ist ein grosses Experiment für die Psyche. Der Ausgang ist ungewiss.»
Wie stärke ich meine psychische Gesundheit?
Der Beobachter-Gesundheits-Newsletter. Wissen, was dem Körper guttut.
Lesenswerte Gesundheitsartikel mit einem wöchentlichen Fokusthema. Jeden Montag.