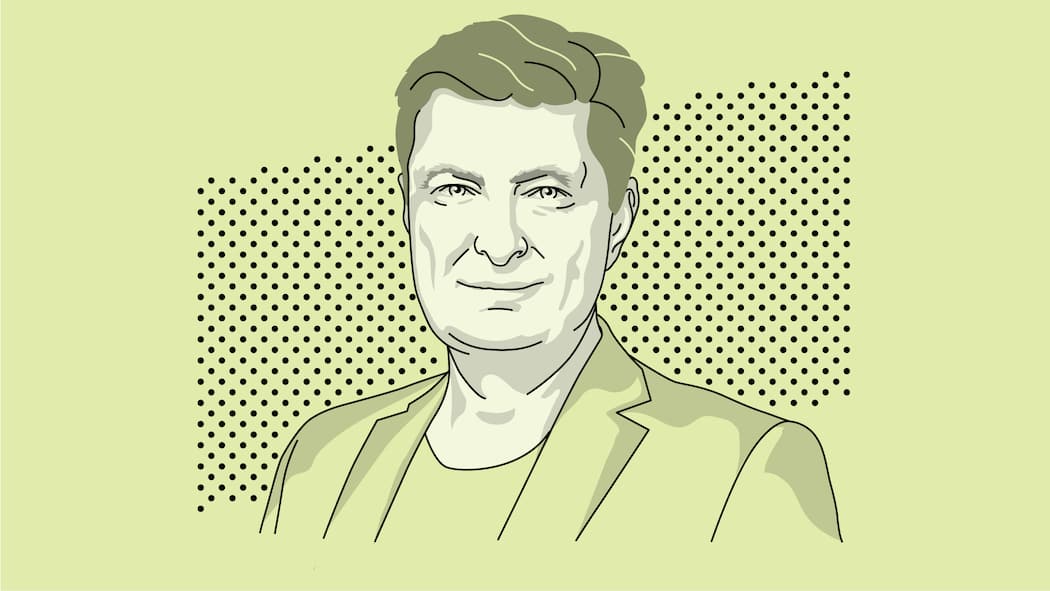Diese verflixte Problemfixierung
Lisa Christ ist Kabarettistin, Satirikerin und Beobachter-Kolumnistin. Beim Velofahren gerät sie ins Grübeln – und hat eine tiefgründige Erkenntnis.
Veröffentlicht am 29. September 2023 - 11:19 Uhr

Steine, Äste, verlorene Mützen oder Handschuhe, ein achtlos fallen gelassener Nuggi: Es gab eine Zeit, in der ich mit meinem Velo fast ausnahmslos über alles fuhr, was mir im Weg lag.
Sobald ich etwas auf der Fahrbahn erblickt hatte, verfiel ich in eine Art Schockstarre. Mein Blick heftete sich an die Hindernisse, und obwohl ich eigentlich ausweichen wollte, war es mir unmöglich. Also hielt ich den Lenker fest, spannte die Bauchmuskeln an, hoffte, dass sich nichts in den Speichen verheddern würde, und fuhr geradewegs auf die Sachen zu.
Nebst einigen Platten und einer Acht im Hinterrad bescherte mir das vor allem ein unangenehmes Gefühl der Hilflosigkeit. Irgendein Schalter im Hirn schien zu klemmen. Ein Umstand, der sich auch in anderen Bereichen meines Lebens widerspiegelte: Gab es irgendwo ein Problem, fixierte ich mich so sehr darauf, als würde sich mir so ein tieferer Sinn offenbaren.
Ich stellte mir immerzu dieselben Fragen: Wie konnte es dazu kommen? Welche Schuld trifft mich? Und: Wie kann ich verhindern, dass sich das wiederholt?
Dabei war es egal, ob es sich um eine Auseinandersetzung in einer Beziehung oder eine heruntergefallene Milchtüte handelte. Zumindest im Fall der Milch ist ja wohl klar, dass man daraus nichts Grossartiges lernen kann und die Schuldfrage niemandem was bringt. Und einen tieferen Sinn hat das auch nicht. Es handelt sich bloss um ein Missgeschick.
Natürlich ist es löblich, wenn man Fehler einsieht und sie nicht wiederholen will. Aber zwischen «Fehler einsehen und möglichst nicht wiederholen» und «stur perfektionistisch sein und sich nichts durchgehen lassen» liegt ziemlich viel Raum. Raum, den ich mir lange nicht zugestand. Weder in der Küche noch auf dem Velo. Wie wenn man lange auf eine Fuge starrt und irgendwann alle anderen Fugen aus dem Sichtfeld verschwinden, war ich blind geworden für die Route, die mich mit nur einer winzigen Handbewegung um ein Hindernis herumgeführt hätte.
Die Kunst liegt also darin, perfektionistische Ansprüche an sich selbst loszulassen und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass Ideale und der Wunsch, es gut zu machen, deswegen nicht verschwinden. Denn mit etwas Abstand wird schnell klar, dass am besten fährt, wer das Hindernis vor sich nicht zu lange fixiert – sondern den Blick bald dorthin richtet, wo der Weg frei ist.