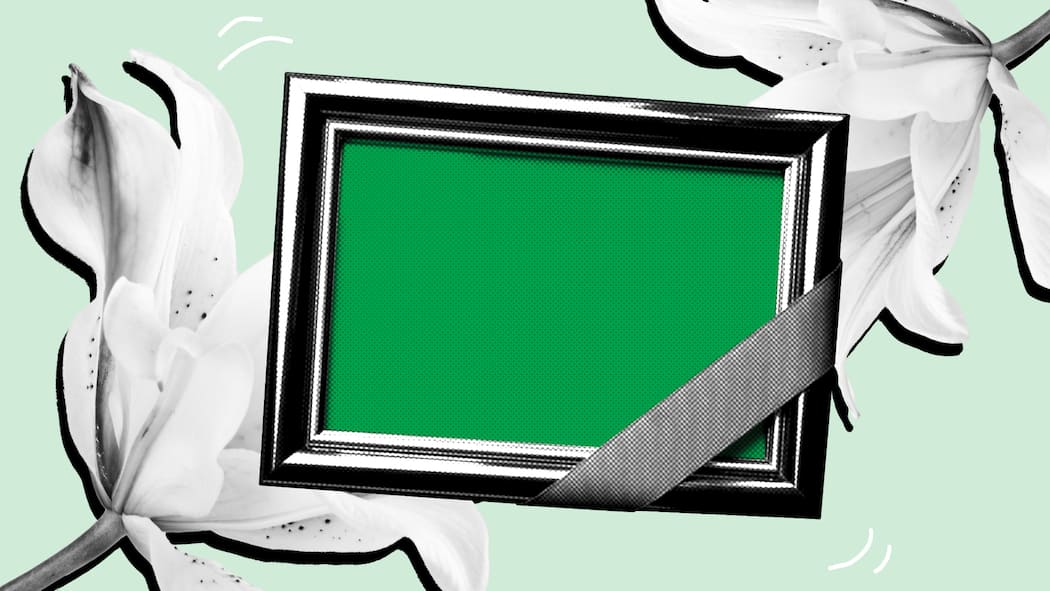Die Schweiz war für Susanna ein Zuhause. Nie aber ein Daheim
Susanna wurde hier geboren. Sie sprach nie eine andere Sprache als Schweizerdeutsch. Trotzdem war sie nur eine vorläufig Aufgenommene, 18 Jahre lang. Dann entschied sie sich zu sterben.

Veröffentlicht am 7. Januar 2022 - 10:13 Uhr

«Wieso habe ich nicht die gleichen Rechte wie alle anderen?» – Diese Frage beschäftigte Susanna (†) ihr Leben lang.
An einem Mittwoch im Frühling 2021 entscheidet sich Susanna zu sterben. Wie an jedem Tag geht sie am Morgen zur Arbeit in den Coiffeursalon in der Nähe des Bahnhofs Wil, wo sie das erste Lehrjahr absolviert. Um 11.30 Uhr verabschiedet sie sich in den Mittag. Um 12.20 Uhr schickt sie ihrer Mutter eine SMS.
Ich liebe dich über alles, aber ich bin sehr sehr müde … Ich habe in meinem Leben keine wünsche mehr oder Freude, diese Gefühle und Gedanken habe ich schon sehr lange. Mit 8 jahren hatte ich diesen Frust und trauer das erste mal, seitdem war es nie wieder gut. Ich habe sehr lange probiert, weiter zu machen und ehrlich glücklich zu sein, ohne immer nur so zu tun oder high sein zu müssen, aber ich kann das einfach nicht mehr. Ich bin kaputt, wie eine Maschine welche nur selten funktioniert … Ich möchte gerne ewig schlafen […]»
Um 12.25 Uhr steigt Susanna vom Perron auf das Gleis. Sie zögert kurz, hebt den Fuss. Der Lokführer denkt, die junge Frau will das Gleis überqueren. Als er sieht, dass sie stehen bleibt, leitet er die Vollbremsung ein. Die Kantonspolizei St. Gallen wird in den Rapport schreiben, dass Susanna sofort tot war.
Bitte endlich eine Antwort
Ein Jahr zuvor habe ich Susanna zum ersten Mal getroffen. Sie wartete vor dem Coop City in Winterthur, eine Zigarette im Mund. Susanna war gross und kräftig. Ihre dunklen Augen betonte sie mit schwarzem Kajal. Um den Hals trug sie ein Nazar-Amulett. Ein tränendes blaues Auge. Es soll vor Bösem bewahren.
Ihr drohe die Ausschaffung, sagte sie in ihrem hellen Ostschweizerdialekt. Sie wisse nicht mehr weiter. Sie möchte endlich eine Antwort auf die Frage, die sie seit Jahren beschäftigt: «Wieso habe ich nicht die gleichen Rechte wie alle anderen?» Susanna wurde in der Schweiz geboren, ging hier zur Schule, sprach nie eine andere Sprache als Schweizerdeutsch. Sie hatte nie etwas verbrochen. Trotzdem galt sie seit Geburt als vorläufig Aufgenommene.
Drei Stunden nach ihrem Tod rief mich ihre Mutter an. Gemeinsam fuhren wir nach Wattwil in Susannas erste eigene Wohnung. Sie bestand aus einem Zimmer mit Kochnische und einem kleinen Balkon mit Blick auf die Einfahrtstrasse. Die Rollläden waren heruntergelassen, Kartonkisten standen unausgepackt herum. Aus zwei übereinanderliegenden Matratzen hatte sie ein Bett gemacht, daneben lag ein schmutziger Kaffeelöffel, der aus einem umgefallenen Becher Schokoladenjoghurt gekippt war. Es sah aus, als wäre sie gerade eingezogen. Susanna hatte fast ein ganzes Jahr hier gelebt. Nach ihrem 18. Geburtstag, im Sommer 2020, war sie bei ihrer Mutter ausgezogen.
Ich verlasse die Wohnung mit zwei Umzugskartons voller Dokumente, Briefe und Schulzeugnisse. Sie sind wie ein Seismograf, der Susannas Leiden dokumentiert. Im Sommer 1999 hatte er erstmals ausgeschlagen.
Susannas Mutter war von Istanbul in die Schweiz geflüchtet und hatte ein Asylgesuch gestellt. Wegen ihrer kurdischen Herkunft werde sie in der Türkei verfolgt, gab sie zu Protokoll. Ihr drohe Haft, weil sie sich geweigert habe, kurdische Landsleute für den türkischen Geheimdienst auszuspionieren. Drei Jahre lang wird sie auf einen Entscheid warten.
Nach einem Jahr mit Gelegenheitsjobs bekommt sie eine Anstellung im «Löwen» in Glattfelden im Zürcher Unterland. Ein Artikel aus der Lokalzeitung zeigt die 28-Jährige mit dem Geschäftsführer. Sie hat schulterlange schwarze Locken und lächelt schüchtern in die Kamera. Fast jeden Abend kommen portugiesische Saisonniers zu ihr an die Bar. Sie arbeiten auf dem Bau. Einer ist besonders lustig und lieb, trinkt viel.
Bald ist sie von ihm schwanger. Im März 2002 kommt ihre Tochter zur Welt, Susanna. Die Mutter gibt ihr den Zweitnamen Pinar, die Quelle.
Befristeter Aufenthalt
Drei Monate später erhält sie Post vom Bundesamt für Flüchtlinge, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) damals hiess. Der Asylantrag wird abgelehnt. Die Beamten glauben ihre Geschichte nicht. Eine Wegweisung erachten sie aber als unzumutbar. Mutter und Kind erhalten eine vorläufige Aufenthaltsbewilligung, befristet auf zwölf Monate. Der F-Ausweis kann jederzeit entzogen werden. Die beiden werden dem Kanton Thurgau zugewiesen, nach Sirnach ins Asylheim.
Im September 2003 heiraten Susannas Eltern. Der Vater stellt ein Gesuch um Familiennachzug. Der Portugiese besitzt eine Aufenthaltsbewilligung und kann für Frau und Tochter ein Bleiberecht beantragen. Die Familie ist nach Dussnang umgezogen, ein Dorf an der Grenze zum Toggenburg. Der Ortsbus hält im Stundentakt an der Hauptstrasse, der Volg ist auch Post und Metzgerei, im Wirtshaus höre ich, wie die Stammgäste über ihre Obstbäume diskutieren. Die Familie wohnt im dritten Stock eines farblosen Wohnblocks am Waldrand.
Das Geld ist immer knapp. Den Lohn gibt der Vater für Heroin aus. Die Mutter hat es nicht bemerkt – bis sie vom Küchenfenster aus beobachtet, wie er im Auto das braune Pulver auf einer Alufolie erhitzt und raucht.
Nach der Arbeit verprügelt er Susannas Mutter. Mehrmals so heftig, dass die Polizei vorbeikommt. Als Susanna zweijährig ist, wird ihre Mutter wieder schwanger. Das sechseinhalb Monate alte Baby im Bauch verliert sie an ihrem 32. Geburtstag – als Folge seiner Schläge.
Sie zeigt ihren Mann nicht an. Sie hat Angst, dass sie in die Türkei zurückgeschickt wird.
Immer wieder flüchtet die Mutter mit der dreijährigen Susanna ins Frauenhaus. Ihre Sorgen ertränkt sie im Wodka. Nur im Rausch vergisst sie die Schmerzen und findet Schlaf.
Im Januar 2006, Susanna wird bald fünf, teilt das Thurgauer Ausländeramt mit, dass das Gesuch um Familiennachzug nicht bearbeitet werden könne. Der Vater war betrunken am Steuer erwischt worden. «Vor Abschluss aller Strafverfahren können wir auf ein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Ihre Ehefrau und Ihre Tochter nicht eintreten.»
Diese Mitteilung war eine «gravierende Fehlleistung», sagt der auf Migrationsrecht spezialisierte Anwalt Marc Spescha. Zum einen gelte für den verdächtigten Vater die Unschuldsvermutung. Ein Strafverfahren sei ja noch kein Urteil. Zudem hätte das Gesuch zwingend nach dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU beurteilt werden müssen. «Spätestens nach der Heirat der Eltern hätten Susanna und die Mutter eine Aufenthaltsbewilligung erhalten müssen», sagt Spescha.
Mutter und Tochter bleiben im Flüchtlingsstatus. Der Vater kommt wegen Drogen-, Vermögens- und Gewaltdelikten in die Strafanstalt Saxerriet. Nach der zweijährigen Haft wird er des Landes verwiesen. Es kommt zur Scheidung. Die Mutter erhält das alleinige Sorgerecht.
«Ja, es stimmt, ich habe der Mutter ein paar auf die Fresse gegeben», sagt der Vater am Telefon. Susanna aber habe er immer geliebt. Mehr habe er nicht zu sagen.
Von Pflegefamilie zu Pflegefamilie
Die Mutter trinkt weiter. Nach der Scheidung hat sie Angst, ausgeschafft zu werden. Ihr psychischer Zustand verschlechtert sich. Als Susanna sechs ist, kommt die Mutter in die Klinik. Sie überlebt einen Suizidversuch. Die Kesb sieht das Wohl des Kindes gefährdet und platziert es in einer SOS-Pflegefamilie.
In den nächsten acht Jahren wird Susanna in fünf verschiedenen Pflegefamilien leben. Ihre Zeichnungen von damals zeigen ein halbes Haus, einen halben Baum, eine halbe Sonne. Die Psychologin meint, das sei, weil sie zwar ein Zuhause habe, aber kein Daheim. Als die Pflegeeltern sie auffordern, ganze Häuser zu malen, hört sie damit auf.
Susannas Mutter ist immer wieder in der Psychiatrie. Aus der attraktiven Barkeeperin ist eine misstrauische, von Medikamenten aufgedunsene Frau geworden, die älter aussieht, als es ihre 42 Jahre vermuten lassen.
Im Herbst 2014 hat sie sich erholt, und Susanna darf nach Hause. Ein Wendepunkt. Nichts hat sich die 13-Jährige sehnlicher gewünscht. «Aber ich fühlte mich auf einmal als Ausländerin», erzählte mir Susanna. In den Pflegefamilien hatte sie dieses Gefühl nie. Sie konnte mit ihnen in die Ferien reisen, niemand sagte etwas wegen ihrer Aufenthaltsbewilligung.
Das Gefühl des Fremdseins verstärkt sich in der Dorfschule. Dort erlebt Susanna, dass sie anders ist. Während die Klassenkameraden in den Turnverein gehen, holt sie auf der Bank das Geld von der Sozialhilfe ab und teilt es für sich und ihre Mutter ein.
Gegen Ende der Oberstufe haben alle eine Lehrstelle. Sie aber erhält eine Absage nach der anderen. Als vorläufig Aufgenommene habe sie schlechte Chancen, sagen ihr die Lehrpersonen.
Beim Abschlusstheater hätte Susanna die Hauptrolle spielen sollen. «Meine Mutter war stolz auf mich», erzählte sie. Die Sticheleien der Mitschüler wegen ihres Status setzen ihr aber immer mehr zu. Kurz vor der Aufführung gibt sie die Rolle ab. «Ich will nicht auf einer Bühne stehen, wenn niemand mich sehen will.»
Danach geht sie nicht mehr zur Schule. Es sind nur noch ein paar Wochen bis zu den Sommerferien. Susanna denkt das erste Mal an Suizid.
Die Schulleitung erstattet Anzeige wegen «Widerhandlung gegen das Volksschulgesetz». Die Kesb bittet Susanna und ihre Mutter zu einer Aussprache. Das Gespräch eskaliert. Die Kesb-Mitarbeiterinnen hätten ihr gedroht, sie werde ausgeschafft, sollte sie keine Lehrstelle finden, bis sie volljährig ist, sagt Susanna. Diese Aussage wird sich tief drin in ihrem Hirn einnisten. Und wuchern wie ein bösartiger Tumor.
Die Kesb schreibt später in einem Bericht, es sei äusserst unklar, wie das Migrationsamt nach der Volljährigkeit von Susanna verfahren werde. Susanna habe einen portugiesischen Pass und nicht wie ihre Mutter einen türkischen. «Eine Wegweisung nach Portugal wäre sicherlich weder unzulässig noch unzumutbar, noch unmöglich.» Da Susanna kein Portugiesisch spreche, sei es wichtig, dass sie über einen Arbeitsvertrag verfüge, damit sie in der Schweiz bleiben könne.
Mutterseelenallein
Die Kesb sieht das Wohl von Susanna auch durch die Mutter gefährdet. Viele Institutionen hätten versucht zu helfen. Stets aber habe die Mutter die beteiligten Personen heftig beschimpft. «Die Mutter ist psychisch schwer krank», schreibt die Kesb.
Susanna erzählte mir, ihr sei damals bewusst geworden, dass es nur noch sie und ihre Mutter gebe. «Der Rest ist gegen uns.»
Wegen «drängender Suizidgedanken» verbringt die 15-Jährige die Sommerferien nach der Oberstufe in der Psychiatrie. Danach besucht sie das zehnte Schuljahr in Frauenfeld, bricht aber nach wenigen Wochen ab.
Fünf Tage vor ihrem 16. Geburtstag schreibt ihre Psychiaterin dem Migrationsamt Thurgau einen Brief. Susanna habe massive Zukunftsängste, die vor allem mit ihrem Aufenthaltsstatus zu tun hätten. «Aus fachärztlicher Sicht empfehlen wir eine definitive Aufenthaltsbewilligung für Susanna, um ihr die Möglichkeit zu geben, sich psychisch zu stabilisieren und die Aufgabe ‹Leben› gut meistern zu können.»
Das Migrationsamt lehnt das Gesuch ab. Es sei wohl der zehnte negative Bescheid gewesen, sagt Susanna. Jedes Jahr mit derselben Begründung. Da sie minderjährig ist, wird ihr Gesuch an jenes ihrer Mutter gekoppelt. Wegen Sozialhilfeschulden und kleinerer Delikte erfüllt die Mutter die Voraussetzungen für eine reguläre Aufenthaltsbewilligung nicht. Daran ändern auch die Rekurse der Anwälte nichts.
Sie waren vielleicht nicht die richtigen. Anwalt Marc Spescha verfolgt die Behördenpraxis seit 30 Jahren. Er sagt: «Susanna hätte gemäss geltendem Recht längst eine Aufenthaltsbewilligung erhalten müssen, spätestens mit zwölf Jahren.» Sie erfülle die Voraussetzungen für einen Härtefall und man hätte ihr unabhängig von allfälligen Verfehlungen der Mutter einen B-Ausweis erteilen müssen.
Fehlerhafte Verfügungen und mangelnde Sachkenntnis seien nichts Ungewöhnliches, sagt Spescha. In vielen Migrationsämtern herrsche die Meinung vor, dass eine möglichst restriktive Einwanderungspolitik umgesetzt werden müsse. Er beobachtet «einen Geist der Abwehr».
Seit langem empfiehlt die Eidgenössische Migrationskommission, dass Personen ohne Aufenthaltsbewilligung spätestens nach sechs Jahren eine reguläre Aufenthaltsbewilligung bekommen sollen. Menschen auf unbegrenzte Zeit in der Schwebe zu lassen, hält sie «aus integrationspolitischer Sicht» für problematisch. Die Forderung blieb politisch bisher ohne Chance. Rund 50'000 Personen leben als vorläufig Aufgenommene in der Schweiz. Knapp 7300 sind hier geboren.
Das Thurgauer Migrationsamt schreibt zu den Vorwürfen: «Die Aufgabe der Migrationsbehörden ist es, das jeweils geltende Bundesrecht zu vollziehen. Gegen jeden getroffenen Entscheid der Migrationsbehörden kann Rekurs erhoben werden, um die Verfügung gerichtlich überprüfen zu lassen.»
Man ist zufrieden, aber …
Ich erzählte Susanna von Speschas Einschätzung. Sie wusste, dass es wohl schwierig gewesen wäre, sie auszuweisen. Trotzdem plagte sie die Ungewissheit. «Ich habe das Gefühl, niemand hat ein Interesse, dass ich eine Ausbildung starte und mich entwickle. Mit dem F-Ausweis muss ich die Dreckjobs machen. Alles bleibt immer nur Minimum, Minimum, Minimum. Wie bei meiner Mutter.»
Die Antworten, die sie auf ihre Bewerbungen bekommt, bestätigen sie darin: Eigentlich sei man zufrieden, wie sie arbeite, doch mit dem F-Ausweis sei alles zu kompliziert. Im Sommer 2019, Susanna ist jetzt 17, findet sie endlich eine Anstellung als Praktikantin in einem Coiffeursalon in Wil – für 50 Franken im Monat. Ein Jahr später beginnt sie dort die dreijährige Lehre.
Kurz danach schickt mir Susanna ein Foto. Es zeigt eine Aufenthaltsbewilligung mit ihrem Gesicht darauf. Nichts weiter. Kein Emoji. Kein «Ich freue mich, endlich hat es geklappt». Nichts. Irritiert und erfreut zugleich schreibe ich ihr, dass sich nun hoffentlich alles zum Guten wende.
Später wird sich zeigen: Die Bewilligung bedeutet ihr nicht viel. Nicht einmal ihrer besten Freundin Jessica erzählt sie davon. Vielleicht war es schon zu spät. Vielleicht ging es aber nie nur um die Bewilligung.
Auf dem Ausweis heisst es unter «Anmerkung»: «Aufenthalt zur Ausbildung mit Praktikum, befristet auf ein Jahr.» Das Migrationsamt macht sie darauf aufmerksam, «dass spätestens zum Zeitpunkt des Lehrabschlusses die Voraussetzungen für einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz vollumfänglich erfüllt werden müssen».
Im Spätherbst 2020 isoliert sich Susanna zunehmend. «Ich habe sie immer wieder gefragt, ob sie am Wochenende etwas unternehmen möchte», erzählt Jessica. «Sie hat immer wieder kurzfristig abgesagt.» Irgendwann habe sie aufgehört zu fragen. Auch bei mir meldet sich Susanna nicht mehr. Und auch ich frage nicht nach. Jessica sieht ihre beste Freundin nur noch im Bus zur Arbeit. Die Fröhlichkeit von früher sei verschwunden gewesen. Sie habe nicht mehr gelächelt.
Nach ihrem Tod finden die Kantonspolizisten Susannas Rucksack im Coiffeurgeschäft. Er ist voller ungeöffneter Briefe. Eine gerichtliche Vorladung wegen einer Mietstreitigkeit. Die Wohngemeinde fordert Unterlagen zur Berechnung der Ergänzungsleistungen. Eine Arztpraxis droht mit Betreibung. Ein Brief vom Migrationsamt. Ihr B-Ausweis verfalle demnächst. Sie müsse ein Verlängerungsgesuch stellen.
«Es ist nichts spezielles passiert, dass ich das heute mache, ich wollte schon am wochenende deine medikamente klauen und alles schlucken, aber ich wollte nicht dass du mich so findest, ich hab lange darüber nachgedacht, aber alles woran ich denken kann wenn ich morgens aufstehe ist zu sterben. Den ganzen Tag lang bis ich abends nach hause komme und ins Bett gehe. Ich weine viel und oft, aber ich zeige das niemandem, nur in letzter zeit weil ich mein limit erreicht habe und es nicht mehr halten konnte. Du bist für nichts schuld! Du hast alles getan was du konntest. Ich liebe dich bis Pluto und zurück.»
Susanna wird an einem viel zu sonnigen Junitag beerdigt. Ihre Chefin kommt nicht, niemand von der Kesb, niemand von der Gemeinde, niemand vom Migrationsamt, auch ihr Vater nicht. Drei Friedhofsmitarbeiter lassen den Holzsarg in die Tiefe und schütten Erde hinterher. Der Pfarrer sprenkelt Weihwasser und spricht Gebete. Den Suizid erwähnt er mit keinem Wort. Die Schweiz war für Susanna ein Zuhause. Nie aber ein Daheim.
Stecken Sie in einer Krise oder haben Sie Suizidgedanken? Kennen Sie Betroffene? Reden Sie darüber. Und holen Sie Hilfe.
- Dargebotene Hand, Telefon 143 oder www.143.ch (SMS, E-Mail, Chat)
- Pro Mente Sana: 0848 800 858 (auch für Angehörige, Bürozeiten)
- Elternberatung der Pro Juventute: 058 261 61 61
- Elternnotruf: 0848 354 555
- Hinterbliebene: www.trauernetz.ch
- Weitere Informationen und Kontaktstellen auf www.reden-kann-retten.ch
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.