Vergesst die jungen Überlebenskünstler nicht
Während der Corona-Massnahmen wurden die Jugendlichen allein gelassen. Das machte vor allem jenen zu schaffen, die wenig privilegiert aufwachsen. Wie geht es ihnen heute? Ein Besuch im Bieler Jugendtreff Villa Ritter.

Veröffentlicht am 21. Juli 2022 - 20:53 Uhr

Mourad* (Name geändert), 20, hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Schon wieder. Das kann er gut. Fast am besten im Leben. Sagt er. Kopfhörer in den Ohren, das Handy zwischen den Fingern. Seine Augen auf dem Gerät, natürlich. Nicht auf Santina. Santina, die ihm sagt, dass das Leben aus mehr besteht als aus schlechten Entscheidungen. Nicht sein Leben, sagt Mourad. Santina schweigt.
Sein Zuhause war immer ein schwieriger Ort für Mourad. Mit 16 ist er ausgezogen. Und die Villa Ritter, der Jugendtreff in der Juravorstadt, ist zu seinem Ort geworden. Sozialarbeiterin Santina und Sozialarbeiter Aurèle zu seinen wichtigsten erwachsenen Bezugspersonen. Er braucht sie. Auch jetzt wieder.
«Ich hätte einfach sagen sollen, dass ich einen Joint geraucht habe.» Stattdessen hat er die Urinprobe eines Kollegen abgegeben und seine Bewerbung für eine Lehrstelle bei den SBB in den Sand gesetzt. Eine Bewerbung, die er vom Computer der «Villa» losgeschickt hat. Wie so viele andere auch. Seit drei Jahren sucht er erfolglos. Er, der sein Wissen als wertvollsten Besitz listet und endlich arbeiten und zufrieden sein will.
Auch Dema*, Kevin, Héloise*, Melvin*, Inès* und Flaubert brauchen den Jugendtreff Villa Ritter. Er ist ihr Fixpunkt in einem belasteten Leben.
Seit 50 Jahren für alle offen
Um Mourad und Santina wird es lauter. Irgendwo dröhnt Dr. Dre, ein E-Piano versucht mitzuhalten. Und bei einem Tischfussballmatch werden wohl gerade die entscheidenden Bälle versenkt. Die Sofas füllen sich. Santina und Aurèle wissen nicht, wie viele ihrer Jugendlichen heute kommen werden. 60 oder 70, schätzen sie. Freitagabend und Regen. Doch die «Villa» steht immer für sie offen. Seit 50 Jahren schon.
Damals war die «Villa» wirklich eine Villa, kein Neubau mit stolzen Graffiti und einem Herz aus abgesessenen Sofas. Entstanden ist sie aus einem Mangel an Orten für die welschen Jugendlichen der zweisprachigen Stadt. Sie ist für alle offen, «un centre d’animation pour la jeunesse». Finanziell unterstützt wird sie durch die beiden Landeskirchen und die Stadt Biel.
Die meisten Jugendlichen an diesem Abend reden französisch. Viele von ihnen haben Pässe und Wurzeln in anderen Ländern. Biel, die Schweizer Sozialhilfe-Hauptstadt, ihre Heimat, ist ein schwieriges Pflaster.
Santina weiss das. «In Biel eine Lehrstelle zu finden, ist eh schon schwierig.» Noch schwieriger aber sei es, wenn man hauptsächlich Französisch spreche, denn die meisten Lehrstellen sind deutschsprachig. Noch viel schwieriger sei es, wenn man keine Eltern hinter sich habe, die unterstützen. Und fast unmöglich werde es schliesslich, wenn man dann auch noch die Schule abgebrochen habe. «Mit diesen Schwierigkeiten kämpfen unsere Jugendlichen jeden Tag.» Seit zwölf Jahren arbeitet die 37-Jährige schon als Sozialarbeiterin in der «Villa». Die Sorgen, die sie hört, sind all die Jahre die gleichen geblieben: Arbeit, Sexualität und Gewalt. In dieser Reihenfolge.
«Unsere Arbeit ist wichtig. Aber weiss das die Schweiz?»
Aurèle, 41, Sozialarbeiter
Geteilte Erfahrungen
Dema, 15, ist hier, weil seine Freunde hier sind. Französisch spricht er nur wenig. Deutsch gar nicht. Er ist erst seit sechs Monaten in der Schweiz, hat aber schon gelernt, dass man sich auf das Wetter nicht verlassen kann. Dafür auf die Freunde umso mehr. Zu dritt sind sie, 13, 16, und 17 Jahre alt. Sie teilen die Erfahrung, dass sie mitten in der Pandemie mit ihrer Familie in ein neues Leben starten mussten. Neues Land, neues Glück. Hoffentlich.
Kevin, 15, hört bei rassistischen Kommentaren einfach weg. «Ich habe die Schweiz zu meinem Zuhause gemacht. Darauf bin ich stolz.» Abstimmen darf er hier nicht, er wüsste auch gar nicht, was er denn genau stimmen soll. «Zu viele Meinungen, zu viel Lärm.» Er will Koch werden oder Maler und hat bessere Karten als seine Freunde in Biel. Er wohnt am östlichen Ende des Kantons und spricht breitestes Berndeutsch.
Der Shutdown hat viel zerstört
«Die Jugendlichen kommen hierher, weil sie nicht nach Hause wollen», sagt Sozialarbeiter Aurèle. Er war Lehrer in einem früheren Leben. In der Arbeit in der «Villa» sieht der 41-Jährige aber mehr Sinn, trotz weniger Lohn. Zu Hause warteten nicht selten Spannungen auf die Jugendlichen. Enge Zimmer, enge Budgets oder Gewalt. In der «Villa» nur ihre Freunde. Und Santina und Aurèle. Die ihnen schon an der Eingangstüre anmerken, wenn ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Und mit der Schule telefonieren können, zum Beispiel. Mit den Lehrmeisterinnen. Oder auch mit dem Jugendschutz, wenn nötig.
«Unsere Arbeit ist wichtig», sagt Aurèle. «Aber weiss das die Schweiz?» Wahrscheinlich nicht. Während des Shutdowns mussten die Türen der Villa geschlossen bleiben. Die Massnahme galt ausschliesslich der körperlichen Gesundheit. Den Jugendlichen wurde ihr Zufluchtsort genommen.
Nach der Pandemie sind sie verschwiegener in die «Villa» zurückgekehrt. Auch Héloise. Sorgen, die gross waren, wurden grösser. Aurèle und Santina haben es mit Einzelterminen versucht. Aber fast alle Jugendlichen lehnten ab. Erwachsenen zu vertrauen, ist einfacher, wenn die Freunde in der Nähe sind. «So funktioniert unsere Arbeit eben», sagt Aurèle.

Héloise, 16, hindert wenig am Einschlafen. Jetzt, da sie allein wohnt. Auch die Klimakrise nicht. «Alles kommt, wie es kommen muss», sagt sie und kreuzt ihre blassrosa Kunstnägel fürs Foto. Das ist alles, was man von ihr zu sehen bekommen soll. Auch über Corona will sie nicht sprechen, lieber darüber, dass Opfern von sexualisierter Gewalt immer noch die Schuld in die Schuhe geschoben wird. «Es geht doch nicht darum, wie oft sie Nein gesagt hat oder wie kurz ihr Rock war.» Ein trauriger Schimmer in ihren Augen. In zehn Jahren werde sie in einer grossen, schönen Wohnung leben. Ohne Mann. Sie werde Hebamme sein. Ihr Traumberuf. Das Krippenpraktikum, für das sie sich heute beworben hat, ist der erste Schritt.
In der Gemeinschaftsküche dampft Risotto. Ein «Villa»-Znacht, zum ersten Mal seit der Pandemie. Mit Schinkengipfeli als Apéro, typisch Schweiz. Es wird viel gelacht. Und die neuen Sorgen gehen fast vergessen. Aber nur fast.
Das Haus erhält immer weniger Geld
Die «Villa» hat Geldprobleme. Hatte eigentlich schon immer Geldprobleme, aber den Landeskirchen spült es jedes Jahr weniger Geld in die Kassen. Zu spüren bekommen das vor allem die Projekte, die von ihnen unterstützt werden. Wie die Villa Ritter. Auch die Stadt Biel spart und wird auf das Jahr 2023 hin 10'000 Franken weniger an Subventionen zahlen. Diese Nachricht ist neu und liegt Aurèle und Santina schwer im Magen.
Inès, 15, will Magierin werden. Oder Polizistin. Was sie beschäftigt? Ihre Erzfeindin. Ihre Freundin kichert. Und auch, dass der Polizei immer weniger Respekt entgegengebracht werde.
Melvin, 15, wünscht sich, dass die Polizei sein Gesicht vergisst. «La police me fait chier! Zum Kotzen, die Polizei! Verdiene ich denn keine zweite Chance?» Er ist scheu. Scheuer, als er tut. Schulabbruch, Vorstrafe. Sucht schon lange nach einem Praktikum in einem Heim. Wünscht sich Glück und Gesundheit für seine Familie und Erfolg für den FC Biel. Er spielt bei den Junioren. Die Schweiz ist sein Zuhause, mit oder ohne Pass. Hier ist er geboren.
Lebenswichtige Orte
Respektlos, laut, gewalttätig, undankbar. Das ist die Jugend. Zumindest liest und hört man das oft. Was man nicht liest und gern vergisst: wie schlecht es manchen Jugendlichen und ihren Familien in der Schweiz geht. Allem Wohlstand zum Trotz. Das sagt Stefanie Schmidt, Professorin für klinische Psychologie im Kindes- und Jugendalter. «Für sie kann ein Jugendtreff ein wichtiger Ort sein, um mit den Belastungen im Leben besser umgehen zu können.» Während der Pandemie seien solche Orte besonders wichtig gewesen. Schmidt kennt sich aus. Schon länger arbeitet sie mit einer Forschungsgruppe der Universitäten Bern und Zürich an einer Studie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Müsste es nicht im Interesse von uns allen sein, dass Institutionen wie die Villa Ritter überleben können?, fragen Aurèle und Santina. Ja, sagt Schmidt. Das stimme mit den Erkenntnissen der Corona-Studie überein. «Es braucht klar mehr niederschwellige Angebote.» Leider würden die Leistungen der offenen Jugendarbeit oft nicht genügend wissenschaftlich untersucht.
Und entsprechend wenig gewürdigt. Für die Politik fliegt die offene Jugendarbeit deshalb unter dem Radar. Und die Jugend geht vergessen.

Nach dem Znacht sitzt Santina im Büro vor dem Computer. Melvin hat gefragt, ob jemand einen Blick auf seine neueste Bewerbung werfen kann. Auch deshalb war er heute hier. Rundherum hängen Schnappschüsse mit Jugendlichen. Santina atmet aus. «Die ‹Villa› hat mit ihnen eines gemeinsam. Sie sind Überlebenskünstler.»
Flaubert, 21, kommt schon in die Villa, seit er 13 war. Nachts plagt ihn die Sorge um seinen Praktikumsplatz. Er will ihn nicht verlieren. Auch er ist von zu Hause ausgezogen. Und ist eigentlich schon lange zu alt für den Jugendtreff. Mourad, 20, genauso. Die «Villa» ist nur für Jugendliche bis 18. Doch sie ist das Zuhause geblieben, das sie sonst nirgends gefunden haben.
Stefanie Schmidt, wie geht es der Schweizer Jugend nach der Pandemie?
Die meisten haben Corona toll gemeistert. Trotzdem müssen wir als Gesellschaft genauer hinschauen. Denn Jugend ist nicht gleich Jugend.
Was meinen Sie damit?
Von den psychischen Folgen der Pandemie waren vor allem die Jugendlichen betroffen, die schon vorher belastet waren. Ein Risikofaktor sind neben psychischen Diagnosen auch prekäre Verhältnisse zu Hause.
Hat man die psychische Belastung der Jugend einfach in Kauf genommen?
Im Vergleich zu den körperlichen Belastungen rückte sie spät in den Fokus. Die Folgen für die Jugendlichen schienen weniger ernst als für die ältere Generation.
Was ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Corona-Studie?
Es braucht mehr niederschwellige Angebote, wie etwa Jugendtreffs. Die meisten psychischen Erkrankungen beginnen im Jugendalter. Hier wäre die Chance für Präventionsarbeit am grössten. Zu hoffen ist auch, dass man in einer ähnlichen Situation künftig Massnahmen für die physische und die psychische Gesundheit gut kombiniert.
Stefanie Schmidt ist Professorin für klinische Psychologie im Kindes- und Jugendalter.
Dieser Artikel ist Teil der Beobachter-Sonderausgabe «Hallo Helvetia».
Zum 1. August widmen wir eine Beobachter-Ausgabe ganz der Schweiz: Unsere Redaktorinnen und Redaktoren sind für «Hallo Helvetia» zu Entdeckungsreisen ausgeschwärmt und zeigen ein facettenreiches Bild unseres Landes im Jahr 2022.
Sie haben interessanten Stoff für zahlreiche Berichte gesammelt: Gespräche mit spannenden Menschen, überraschende Entdeckungen, Einblicke in aktuelle Entwicklungen und schwelende Konflikte. Es geht um Heimat und Identifikation, um Trennendes und Verbindendes.

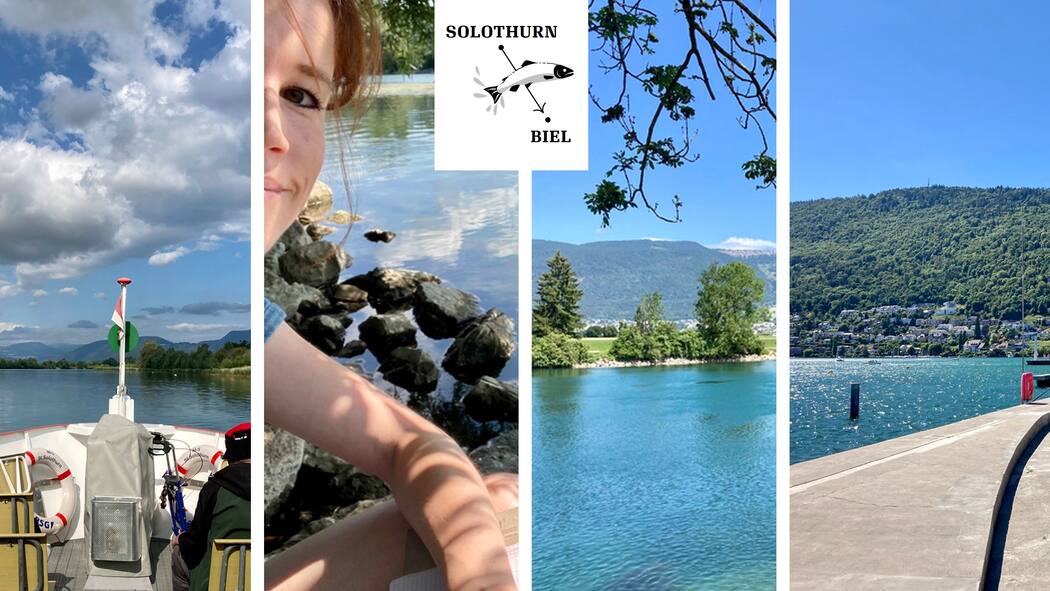




2 Kommentare
Wenn Kinder vergessen wurden, dann von deren Eltern, welche sich nicht IHREN elterlichen Pflichten entsprechend verhielten, verhalten haben!
Kinder machen, ist nicht schwer, Kinder ganzheitlich, verantwortungsbewusst erziehen, umso mehr!
Drum prüfe/überlege gut, wer Kinder haben möchte!!
Als eindeutig Nicht-Junger kann ich versichern, dass auch ältere Generationen diese Pandemie nicht einfacher empfinden, weil existenzielle Erfahrungen nicht eine Frage des Alters sind.
Wer älter wird, wird dies noch erfahren:
Auch in späteren Lebensabschnitten gibt es unzählige lebenswerte Dinge zu entdecken, zu erleben und zu lernen. Deren Fehlen/Wegfallen zeigt sich zwar in dieser Krise je nach Generation in anderen Dingen als in Form von Ausgang oder Partys oder trister Berufsaussichten.
Aber etwas war in den vergangen Zwei Jahren unübersehbar: In jeder Generation verstärken sich Rücksichtslosigkeiten unter dem frustrierenden Einfluss einer Pandemie. Bei den einen in Form der Bequemlichkeit, seine Abfälle statt im nahestehenden Abfalleimer auf der Wiese zu entsorgen oder in Gestalt ungefragter Beschallung der Umgebung mit wummernden Sounds bei Treffen mit KollegInnen, bei den anderen in Form renitenter Maskenverweigerung und wieder andere missachten gleich vollends gesetzliche Vorgaben zum Schutz der Mitmenschen.
Tatsache bleibt aber: Jede Generation kann durch eine solche Krise in diese unglückliche Situation geraten und das Gefühl haben, dass uns Lebenszeit verloren geht.
Dies einfach darum, weil bei bewusster Lebensführung jeder Lebensabschnitt einzigartig und bedeutsam und somit unersetzlich ist.
Das Verharren in Vergleichen, welche Generation jetzt mehr leide, halte ich darum weder für zielführend noch hilfreich.