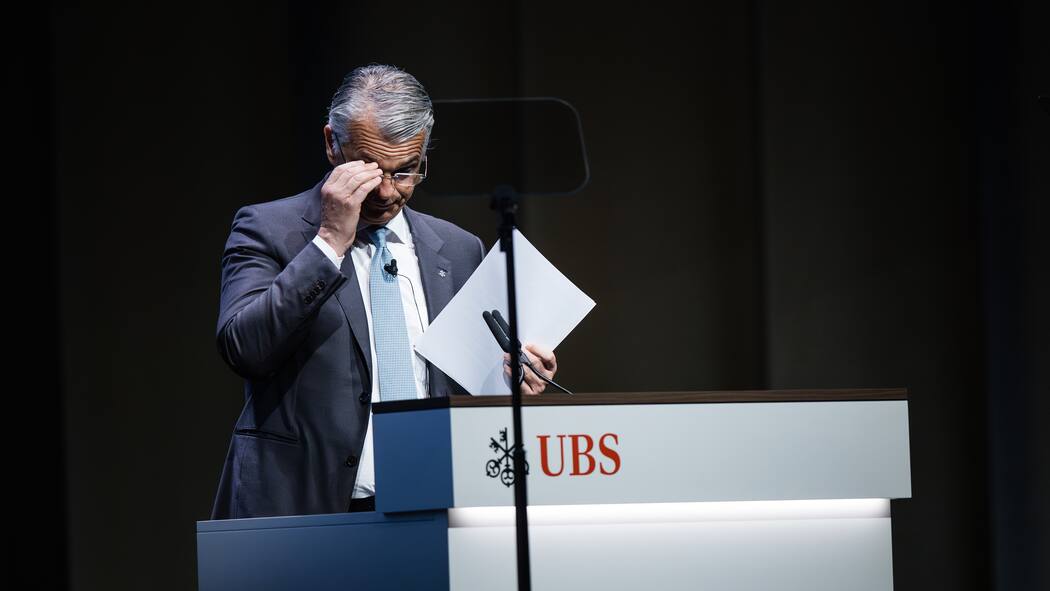Warum ein Gericht Bonuskürzungen bei der CS kippte
Die Bonuskürzungen bei der Credit Suisse sind unrechtmässig, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Es argumentiert mit der Eigentumsgarantie.

Veröffentlicht am 15. Mai 2025 - 17:17 Uhr

Der Bundesrat darf dem CS-Kader die Boni nicht kürzen.
Die Bonuskürzungen in der ehemaligen Teppichetage der Credit Suisse (CS) sind nicht rechtmässig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) entschieden. Es argumentiert, dass es keine genügende gesetzliche Grundlage für solche Massnahmen gibt, sobald die Staatshilfen zurückgezahlt sind.
Die Credit Suisse zahlte die im Rahmen der Notfusion mit der UBS gewährten Staatshilfen im August 2023 vollständig zurück. Die Streichung der Boni sei ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsgarantie.
Diese schützt Hab und Gut vor ungerechtfertigten Eingriffen durch den Staat. Er darf keiner natürlichen oder juristischen Person deren Eigentum – beispielsweise ein Haus, Land oder eben einen Bonus – einfach wegnehmen oder einen daran hindern, es zu benutzen. Die Eigentumsgarantie steht im Artikel 26 der Bundesverfassung (BV).
Ausnahme: Enteignung
Es gibt aber Ausnahmen: Grundrechte können laut Artikel 36 der BV eingeschränkt werden, wenn es verhältnismässig ist und sowohl eine gesetzliche Grundlage als auch ein überwiegendes öffentliches Interesse dafür besteht. Wenn es also im öffentlichen Interesse ist (etwa für den Bau einer Strasse) und man dafür entschädigt wird, darf der Staat Eigentum enteignen. Bei der Gegenleistung handelt es sich in der Regel um Geld.
Ein Bonus wird laut Obligationenrecht dann zum Eigentum, wenn er vertraglich oder verbindlich zugesagt wurde. Sobald er auf dem Konto ist oder rechtlich zugesichert wurde, greift die Eigentumsgarantie.
Besagter Fall geht auf die staatlich orchestrierte Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im März 2023 zurück. Zwei Monate nach diesem Ereignis ordnete das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) an, ausstehende Boni für CS-Führungskräfte zu kürzen oder zu streichen. Grundlage dafür war Artikel 10a des Bankengesetzes. Dieser erlaubt dem Bundesrat, variable Vergütungen zu verbieten, wenn eine systemrelevante Bank staatliche Hilfe erhält.
Bonuskürzungen nach Rang
Das EFD ordnete daraufhin am 23. Mai 2023 eine konzernweite Kürzung oder Streichung der ausstehenden Bonuszahlungen in der Höhe von rund 60 Millionen Franken an. Laut dem BVGer sollten diese bei der Geschäftsleitung gestrichen, bei der Ebene direkt darunter um 50 Prozent und zwei Stufen darunter um 25 Prozent gekürzt werden. Diese Entscheidung betraf rund 1000 Personen. Zwölf von ihnen reichten Beschwerde beim BVGer ein.
Der Bundesrat forderte bereits in seinem Bericht zur Bankenstabilität vom 10. April 2024 die Einführung von sogenannten Clawback-Klauseln. Diese würden ermöglichen, bereits ausbezahlte Boni rückwirkend zurückzufordern, sofern sich herausstellt, dass sie auf unzulässigem Verhalten oder Fehlentscheidungen basieren.
- Bundesverwaltungsgericht: Keine Boni-Kürzungen bei ehemaligen CS-Managern
- Fedlex: Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
- Fedlex: Bericht des Bundesrates zur Bankenstabilität
- Fedlex: Obligationenrecht