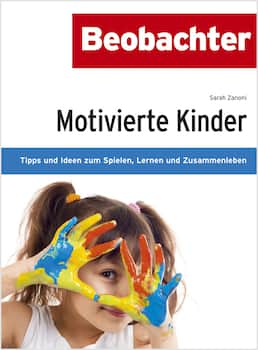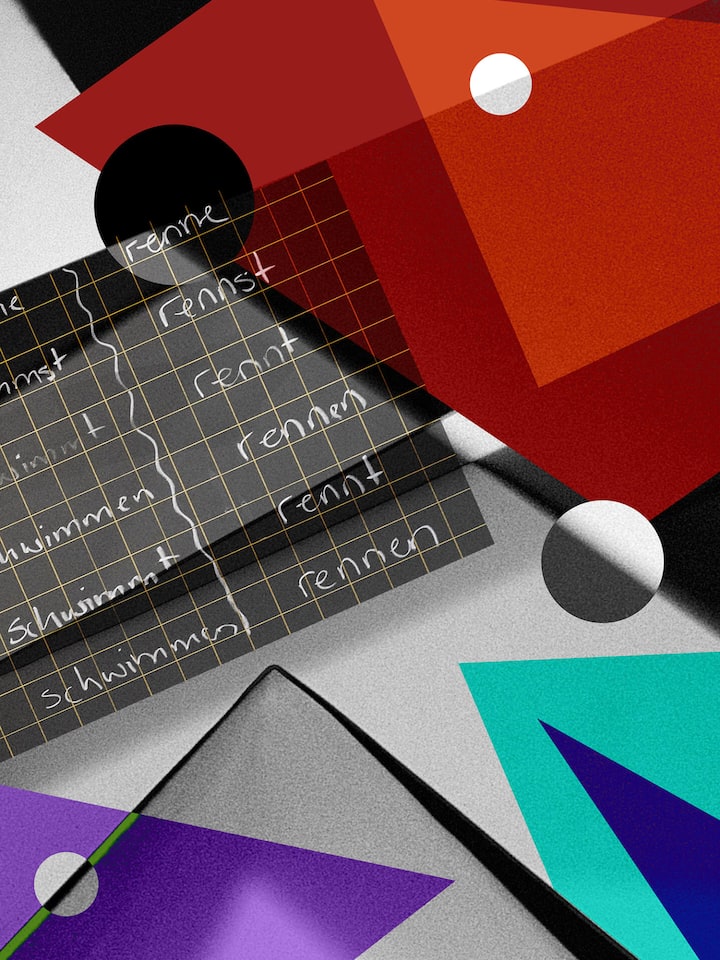Zwischen Trotzphase und Pubertät – so ticken Elfjährige
Weder erwachsen noch Kind: Die Zeit um den elften Geburtstag ist wichtig – und für Jugendliche und Eltern manchmal recht hart.
Veröffentlicht am 15. Oktober 2025 - 16:29 Uhr

Im Vergleich mit anderen kommt es Elfjährigen oft auf Äusserlichkeiten an, zum Beispiel welche Ferienreisen eine Familie macht.
Sind Elfjährige schon gross oder noch klein? Diese Frage stellen sich viele Eltern. So auch die Mama von Dimitri, der gewöhnlich allein zum Sport geht und wieder mal die Turnhose liegengelassen hat. Seine Vergesslichkeit und seine Verträumtheit sind noch sehr kindlich – auch wenn er darauf besteht, gross zu sein und von der Mama fordert, dass sie ihm mehr zutraut.
Die Mutter der zehnjährigen Alissa dagegen ist je länger, je mehr überzeugt, dass das oft zickige Verhalten ihrer Tochter und das ständige Verweilen vor dem Spiegel erste Anzeichen der Pubertät sind.
Jugendliche sind heute früher reif
Tatsächlich setzt die Pubertät etwa fünf Jahre früher ein als vor 150 Jahren. Fachleute vermuten bessere Medizin und besseres Essen als Gründe. Aber auch die höhere Ausschüttung von Stresshormonen, etwa bei Problemen im Umfeld, kann bei Mädchen frühere Regelblutung auslösen.
Die hormonellen Veränderungen gehen den körperlichen meist ein bis zwei Jahre voraus. Wann sie einsetzen, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Den Jungen merkt man äusserlich meist nicht viel an – ausser, dass langsam Pickel spriessen, dass sie in die Höhe schiessen und man mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren kann. Oder dass sie, wie Dimitri, die Haare öfter waschen.
Die Mädchen sind in diesem Alter oft weiter entwickelt. Alissas Körper zeigt weibliche Formen, sie hat Brüste und seit einem Jahr die Regel. Andere Jungen und Mädchen wirken kindlich, wie etwa der zwölfjährige Pascal, der gern mit der Mutter kuschelt und ohne Gutenachtkuss und ‑geschichte nicht einschlafen kann.
Teenager interessieren sich für gesellschaftliche Themen
Kinder in dieser Zwischenphase können sich länger konzentrieren – bis zu 45 Minuten. Und sie beginnen abstrakt zu denken. Sie zeigen zunehmend Interesse an gesellschaftlichen Themen und entwickeln die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln. Sie können sich in die Probleme eines Freundes hineindenken. So meinte Alissa im Gespräch mit der Mutter: «Kein Wunder, dass der Kevin so schüchtern ist, er darf ja nie mitspielen.»
Der Wortschatz wächst sprunghaft, die Fähigkeit, schwierige Sätze zu bilden, nimmt zu. Und auch bei chaotischen Kindern besteht die Hoffnung, dass sie Organisations- und Planungstalent entwickeln.
Gleichaltrige sind ein wichtiger Vergleichsmassstab
Auch ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn spielt in diesem Alter eine grosse Rolle: Gleiches Recht für alle! So lässt es Dimitri nicht über sich ergehen, als die jüngere Schwester Leonie ihm den Stinkefinger zeigt. Er fordert von der Mutter die gleiche Konsequenz wie bei ihm, nämlich eine Kürzung des Taschengeldes. Halten Eltern die Fair-unfair-Regeln nicht ein, steigen die Sprösslinge auf die Barrikaden.
Kinder wollen jetzt auch ergründen, wer sie sind, was ihnen leichtfällt und was weniger. Sie vergleichen sich mit anderen und hoffen, nicht allzu schlecht abzuschneiden – aber auch nicht allzu gut, um möglichst nicht aufzufallen. Die Orientierung an Gleichaltrigen ist zentral. Das Dazugehörigkeitsgefühl steht im Mittelpunkt.
In der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen erfahren Kinder, wie die Gesellschaft funktioniert: mit den Anführern, den Gefolgsleuten, den Schwächeren und den Aussenseitern. Und sie üben sich in sozialem Verhalten, lernen, sich anzupassen, abzugrenzen, zu helfen und Initiative zu ergreifen.
Spürt ein Kind, dass es bei Gleichaltrigen beliebt ist, ist seine Welt in Ordnung. Fühlt es sich ausgeschlossen, leidet es. Jungen tragen ihre Ablehnung eher körperlich aus, indem sie gegen den «Loser» kämpfen. Mädchen tendieren zu Intrigen. Eltern tun gut daran, sich nicht ins Gruppenverhalten einzumischen und ihr Kind in seinem Selbstbewusstsein zu stärken. Geht die Entwicklung aber Richtung Mobbing, muss man unbedingt die Lehrkräfte informieren.
Wie verhalten sich Mädchen und Jungen während der Pubertät? Welche Erfahrungen und körperlichen Veränderungen durchleben sie in dieser Zeit? Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten finden in der Checkliste «Pubertierende Jugendliche» Rat zu diesen und weiteren Erziehungsfragen.
Kinder orientieren sich primär an Äusserlichkeiten
Zur eigenen Identität gehört die eigene Herkunft. Darum ist die Frage «Wer bin ich?» eng verknüpft mit «Was besitzen meine Eltern und jene meiner Freunde? Welches Auto fahren sie? Wie oft gehen sie in die Ferien und wohin?» Auch wenn Erwachsene nicht begeistert sind: Für Kinder in diesem Alter sind solche Äusserlichkeiten ein Kriterium, um Menschen einzuschätzen. Ein zutreffenderes kennen sie noch nicht.
Auch verstehen sie in diesem Alter oft noch nicht, weshalb nicht alle Familien über gleich viel Geld verfügen. Das ändert sich erst im Laufe des Erwachsenwerdens. Bis dahin müssen Eltern immer wieder erklären, warum sie es sich nicht leisten können, in den Ferien nach Australien zu fliegen wie die Familie der besten Freundin.
Eltern müssen Kindern einen Rahmen vorgeben
Eltern werden merken, dass elfjährige Kinder souveräner, harmonischer und ansprechbarer werden. Sie werden aber auch immer öfters Gegenwind zu spüren bekommen. Dann wissen sie, dass die Phase der Pubertät nicht mehr lange auf sich warten lässt. Denn Heranwachsende loten ihre Grenzen aus. Sie versuchen, wie weit sie gehen können und wollen sich ausprobieren. Hier ist es die Aufgabe der Eltern, den Kindern einen Rahmen vorzugeben und auch mal NEIN oder STOPP zu sagen. Denn gerade in der Pubertät brauchen die Kinder Klarheit, Halt und Orientierung.
Ein häufiger Streitpunkt ist das Thema Medien: Wie lange am Smartphone oder vor dem Computer sitzen? Meist sind die Kinder anderer Meinung als die Erwachsenen. Erziehende sollten bemüht sein, ihren Kindern zuzuhören, die Sicht ihrer Dinge zu verstehen und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Gleichzeitig muss den Kindern aber auch klar gemacht werden, dass die Erwachsenen bestimmen. Auch wenn Kinder es nicht wahrhaben wollen, so ahnen sie doch: Eltern wissen über vieles besser Bescheid und können die Risiken besser abschätzen. Denn so selbständig und gross Elfjährige sich auch fühlen: Sie sind immer noch Kinder.
Was können Eltern elfjähriger Kinder tun?
- Darauf vertrauen, dass das eigene Vorbild und die eigenen Einflüsse mehr oder weniger standhalten.
- Auch wenn es nicht immer den Anschein macht: Die Kinder brauchen viel Zuwendung und das Vertrauen, dass die Eltern sie lieben und zu ihnen stehen.
- Im Gespräch und in Beziehung bleiben. Sie sind in einem Alter, in dem man offen mit ihnen reden kann.
- Auf die Geschicklichkeit und den Instinkt der Kinder vertrauen und sie auch einmal allein ihrem wilden Treiben überlassen. Bei aller Freiheit brauchen sie aber einen sicheren Hafen.
- Den Kindern mit Rat zur Seite stehen, ohne sie um jeden Preis davor bewahren zu wollen, eigene Fehler zu machen.
- Auch mal den besten Freund, die beste Freundin zu Ausflügen, Festen oder sogar in die Ferien mitnehmen.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 22. März 2013 veröffentlicht.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.