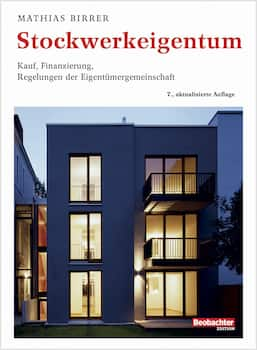Mieter zahlen mehr als Eigentümer – Differenz bleibt konstant
Hauseigentümer sollen nicht entlastet werden, sie seien ohnehin bevorteilt, sagten die Verteidiger des Eigenmietwerts. Die Statistik gibt ihnen recht – widerlegt aber auch viele verbreitete Irrtümer.

Veröffentlicht am 6. Oktober 2025 - 16:16 Uhr

Einfamilienhäuser können sich nur noch die wenigsten leisten – immer mehr weichen auf Stockwerkeigentum aus.
Das Stimmvolk hat entschieden. Der Eigenmietwert wird abgeschafft. Anlass für einen Blick auf die Entwicklung der Wohnkosten von Mietern und Eigentümern in den vergangenen Jahren. Der Beobachter hat dies anhand von Studien untersucht – hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:
Die Abschaffung des Eigenmietwerts entlastet Gutbetuchte – zumindest zurzeit
Der Bund hat keine Zahlen zum Einkommen und Vermögen von Wohneigentümern und Mietenden. Die NZZ liess deshalb eine Auswertung für den Kanton Zürich machen. Ergebnis: Eigentümer haben mehr Vermögen und Einkommen als Mieterinnen. Die Auswertung stütze die These, «dass die Steuerreform in der Tendenz vor allem Entlastungen für Gutbetuchte bringt». Das gilt beim heutigen Zinsniveau. Steigt es jedoch auf etwa 3 Prozent, bedeutet die Reform, dass Eigentümer mehr Steuern zahlen müssen als im jetzigen System.
Mieter zahlen mehr fürs Wohnen als Eigentümer
Laut dem Bundesamt für Wohnungswesen gaben Mieterhaushalte im Jahr 2023 durchschnittlich knapp 25 Prozent ihres Einkommens für Wohnkosten aus. Bei Eigentümerinnen waren es 19 Prozent.
Mieten sind besser tragbar als früher
Gemäss einer Studie des Amts für Wirtschaft des Kantons Zürich sind die Angebotsmieten in der Schweiz in 20 Jahren um 24 Prozent gestiegen. Damit sind die Preise für ausgeschriebene Wohnungen gemeint.
Die Bestandesmieten für Wohnungen ohne Mieterwechsel erhöhten sich dagegen nur um 12 Prozent. Die sogenannten Altbestandesmieten (Mietverhältnisse, die seit mindestens 2005 bestanden) sanken sogar um 4 Prozent (Stadt Zürich: 6 Prozent). Das heisst, wer seit mehr als 20 Jahren in derselben Wohnung lebt, zahlt heute im Schnitt 4 Prozent weniger als beim Einzug.
Die Studie kam auch zum Schluss, dass Mietende Ende 2022 für eine vergleichbare Wohnung einen geringeren Teil des Einkommens aufwenden mussten als 2005. Wohnen wurde also im Verhältnis günstiger. In der Realität ist dies aber kaum zu spüren – wer mehr verdient, leistet sich oft eine bessere und teurere Wohnung.
Die soziale Schere geht auseinander
Bei der Tragbarkeit gibt es allerdings grosse Unterschiede. In der tiefsten Einkommensklasse (Haushaltseinkommen unter 4000 Franken) sind 35 Prozent des Einkommens für Miete und Nebenkosten nötig, in der höchsten (über 12’000 Franken) nur 13 Prozent.
Auch eine neue Studie im Auftrag der Zürcher Handelskammer kommt zum Schluss, dass die durchschnittliche Belastung durch Wohnkosten – ohne dabei zwischen Mietern und Eigentümerinnen zu unterscheiden – zwischen 2006 und 2022 «entgegen weitverbreiteter Wahrnehmung nicht gestiegen, sondern gesunken» ist. Aber: «Die soziale Schere geht auseinander.» Denn für die tiefsten Einkommensklassen ist der Anteil der Wohnkosten am Einkommen auf teilweise über 40 Prozent gestiegen.
Kaufen ist günstiger als Mieten – aber nicht überall
Wohnen Eigentümer im Verhältnis günstiger? Raiffeisen hat das am Beispiel einer Standardwohnung von 100 Quadratmetern durchgerechnet: Ein neuer Käufer müsste – ohne Nebenkosten – mit einer sogenannten Geldmarkthypothek 190 Franken pro Quadratmeter und Jahr zahlen. Bei einer zehnjährigen Festhypothek wären es 270 Franken. Die Miete für die Standardwohnung wäre etwas höher, nämlich 286 Franken.
Das bedeutet: Beim aktuellen Leitzins von 0 Prozent ist eine Geldmarkthypothek um 33 Prozent günstiger als die Miete, eine zehnjährige Festhypothek um 6 Prozent.
In grossen Städten zahlen Mieter bis zu einem Drittel weniger als Käufer.
Das gilt allerdings nicht überall. Der Immobilienspezialist Iazi berechnete im Sommer 2024 für die «Handelszeitung», dass Mieter in grossen Städten und an touristischen Hotspots bis zu einem Drittel weniger zahlen als Käuferinnen. Laut Iazi gilt diese Aussage weiterhin.
Wie sieht es rückwirkend aus? War Wohneigentum über die Jahre günstiger als Mieten? Laut Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile hängt das stark vom Betrachtungszeitraum ab. Auf sehr lange Sicht – Raiffeisen hat 39 Jahre untersucht – waren die Wohnkosten für Mieterinnen nur 6 Prozent höher als für Eigentümer.
Stockwerkeigentum wird immer beliebter – und entsprechend teurer
Weil die Immobilienpreise stetig steigen, kaufen immer mehr Menschen eine Wohnung statt ein Haus, zeigt eine Raiffeisen-Studie. Aber auch Stockwerkeigentum ist für viele unerschwinglich geworden. 2005 gab es für fünfeinhalb durchschnittliche Jahreslöhne eine Neubauwohnung mit 100 Quadratmetern. 2024 brauchte man gut neun Löhne dafür.
Fast eine Billion – die Schulden werden immer grösser
Laut Raiffeisen-Berechnungen nehmen heutige Käuferinnen durchschnittlich 680’000 Franken Schulden auf. Alle privaten Hypotheken zusammen betragen rund 953 Milliarden Franken – fast eine Verdoppelung in 20 Jahren.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 28. September 2025 veröffentlicht.
- NZZ: Abschaffung des Eigenmietwerts: Vor allem Gutbetuchte profitieren
- «Handelszeitung»: In diesen Gemeinden lohnt sich der Eigenheim-Kauf
- «Die Volkswirtschaft»: Sind die Mieten tatsächlich so stark gestiegen?
- Bundesamt für Wohnungswesen: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt 2025/2
- Sotomo-Studie: Wohnraum für Zürich und die Schweiz
- Raiffeisen: Immobilien Schweiz – 3Q 2025
- Mailverkehr mit Fredy Hasenmaile, Raiffeisen
- Mailverkehr mit Nicola Stalder, Iazi
- Mailverkehr mit dem Bundesamt für Statistik