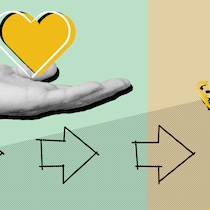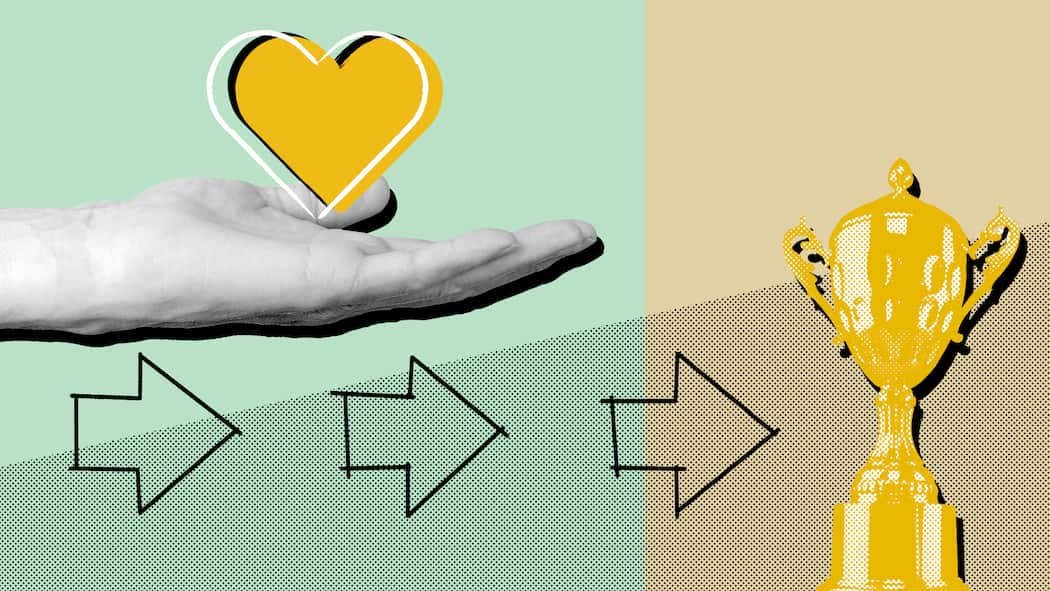Viele haben ein Recht auf diesen AHV-Zustupf – fast niemand kriegt ihn
Betreuungsgutschriften in der AHV sollen die unbezahlte Pflege von Angehörigen belohnen. Eine gute Idee, die in der Praxis scheitert. Das sind die Gründe.

Veröffentlicht am 21. Oktober 2025 - 17:41 Uhr

Wer nahe Angehörige pflegt, kann Betreuungsgutschriften beantragen – aber nur unter gewissen Bedingungen.
Zehntausende Menschen unterstützen ihre Angehörigen im Alltag. Sie springen ein, wenn es alleine nicht mehr geht. Wenn die Spitex zu teuer oder ein Heim keine Option ist. Bezahlt werden pflegende Angehörige selten.
Als Anerkennung dieser Arbeit führte der Bund 1997 die Betreuungsgutschriften in der AHV ein. Sie sind ein fiktiver Zuschlag zum Einkommen, der sich nach der Pensionierung bemerkbar macht. Im Schnitt bringen sie rund 130 Franken mehr Rente pro Jahr. So gehen pflegende Angehörige zumindest nicht ganz leer aus.
Eine gute Idee, doch in der Praxis hapert es. Das zeigen Auswertungen des Bundesamts für Sozialversicherungen für «SRF Espresso»: Nur 10’000 Pensionierte erhalten eine Rente mit Gutschriften. Bei 2,6 Millionen Pensionierten wäre das weniger als ein Prozent. Anspruch hätten wohl deutlich mehr Schweizerinnen und Schweizer.
Was sind die Gründe für die wenigen Anträge?
Problem 1: Die Hürden sind zu hoch
Neben den Betreuungsgutschriften gibt es in der AHV auch Erziehungsgutschriften, die automatisch an Eltern mit Kindern unter 16 Jahren gehen. Betreuungsgutschriften müssen Berechtigte hingegen jedes Jahr neu bei der Ausgleichskasse beantragen.
Dafür müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:
- Die pflegende Person darf noch nicht pensioniert sein.
- Sie muss eine nahe verwandte Person betreuen. Dazu gehören etwa der Ehepartner, ein Kind, Geschwister sowie der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, der oder die seit mindestens fünf Jahren im selben Haushalt lebt.
- Die betreute Person muss in der Nähe wohnen: höchstens eine Stunde oder 30 Kilometer entfernt, an mindestens 180 Tagen im Jahr.
- Die betreute Person muss Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben.
Die Kriterien wurden seit 1997 mehrfach ausgeweitet. Viele fallen trotzdem durchs Raster: «Eine Tochter, die zwei Stunden zur kranken Mutter fährt, hat keinen Anspruch – obwohl ihr Aufwand grösser ist», sagt Corinne Strebel vom Beratungszentrum des Beobachters.
Problem 2: Das Angebot ist wenig bekannt
Einen Antrag zu stellen, setzt ausserdem voraus, dass Berechtigte überhaupt davon wissen. Oft ist das nicht der Fall, wie Organisationen gegenüber «SRF Espresso» bestätigen. Bei Pro Senectute sei die Betreuung von Angehörigen zum Beispiel ein grosses Thema, über die Gutschriften werde aber nur wenig gesprochen.
«Betroffene müssten viel aktiver informiert werden.»
Corinne Strebel, Beobachter-Rechtsexpertin
Ähnlich beim Beobachter: «Unsere Abonnentinnen und Abonnenten fragen kaum danach. Betroffene müssten viel aktiver informiert werden», sagt Rechtsexpertin Corinne Strebel. Zum Beispiel von den Ausgleichskassen.
Problem 3: Viele verzichten aus Scham
Selbst wenn Menschen vom Angebot wissen, stellen sie nicht automatisch einen Antrag. Das ist auch bei Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe so. «Wir sehen bei unserer Arbeit immer wieder, dass Menschen zu lange warten, bis sie sich um finanzielle Unterstützung kümmern. Nach Hilfe fragen ist – zu Unrecht – noch immer mit Scham verbunden», sagt Beat Handschin, Geschäftsführer der Stiftung SOS Beobachter.
Kurz: Betreuungsgutschriften sind ein wichtiger Schritt, um Care-Arbeit anzuerkennen. Dringend nötig wären aber eine bessere Information und niedrigere Hürden.
- «SRF Espresso»: AHV-Betreuungsgutschriften zeigen kaum Wirkung
- Broschüre des Bundes: Betreuungsgutschriften