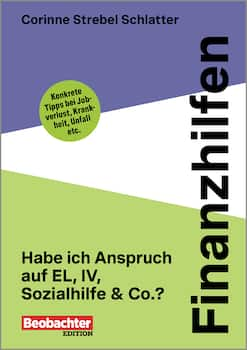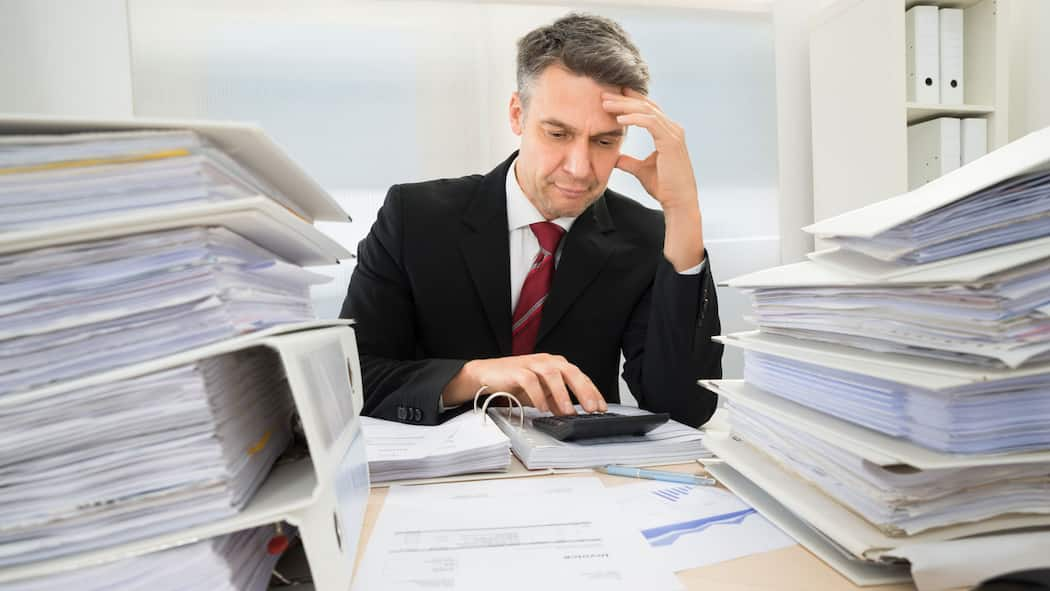Diese Kosten übernimmt die Sozialhilfe
Die staatliche Unterstützung für Bedürftige sorgt immer wieder für rote Köpfe. Was Sie über Grundbedarf, Wohnkosten und Anspruch wissen sollten.

Veröffentlicht am 15. Oktober 2025 - 10:22 Uhr

Die Sozialhilfe deckt nicht nur Wohn- und Lebenshaltungskosten, sondern auch einige ausserordentliche Ausgaben.
Wer hat Anspruch auf Sozialhilfe?
Notlage
Betteln muss in der Schweiz niemand. Wenn alle anderen Stricke gerissen sind, sorgt die Sozialhilfe als letztes Auffangnetz dafür, dass niemand in die absolute Armut fällt. «Wer sich in einer Notlage befindet und sich selbst nicht helfen kann, hat Anspruch auf staatliche Hilfe» – so steht es in Artikel 12 der Bundesverfassung.
Im Jahr 2023 haben in der Schweiz fast 250’000 Personen Sozialhilfe bezogen, was einem Anteil von 2,8 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung entspricht; so wenig wie noch nie seit Beginn der Sozialhilfestatistik.
Wer sich selber helfen kann, muss dies auch tun und seinen Lebensunterhalt mit dem vorhandenen Vermögen bestreiten. Erst wenn dieses aufgebraucht ist oder zur Neige geht, hat man Anspruch auf Sozialhilfe.
Zuständigkeit in den Kantonen
Vermögensfreigrenze
In vielen Kantonen liegt diese Schwelle bei 4000 Franken, in einigen ist sie tiefer, nur in einem ist sie höher. Zudem ist die Sozialhilfe eine subsidiäre Hilfe, sprich: das letzte Auffangnetz.
Wer noch Anspruch auf Lohn oder Arbeitslosengeld, eine AHV- oder IV-Rente, Alimente oder Stipendien hat, muss zuerst die nötigen Schritte unternehmen, um diese Gelder zu erhalten.
Doch nicht alle Menschen, die sich in der Schweiz aufhalten und in Not geraten, haben Anspruch auf finanzielle Unterstützung. Touristen, abgewiesene Asylsuchende sowie Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz erhalten keine Sozialhilfe. Wenn sie in Not geraten, bekommen sie lediglich Nothilfe. Diese fällt viel tiefer aus als die Sozialhilfe und wird oft in Form von Naturalleistungen erbracht.
Haben Sie keine Scheu, Sozialhilfe zu beantragen
Welche Ausgaben deckt die Sozialhilfe?
Grundbedarf
Mit diesem Geld wird der Lebensunterhalt bezahlt. Die Höhe des Betrags ist kantonal unterschiedlich. Der Grundbedarf umfasst Ausgaben für Lebensmittel und Getränke, Kleider und Schuhe, kleinere Haushaltgegenstände, Zeitungen und Bücher. Ausserdem werden mit diesem Geld die Telefon- und Handykosten, die Radio- und TV-Gebühren, Coiffeurbesuche und die Benutzung des öffentlichen Verkehrs finanziert.
Die Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung hingegen muss in den meisten Kantonen nicht aus dem Grundbedarf bezahlt werden, denn die Sozialhilfe übernimmt diese Aufwendungen separat.
Die Höhe des Grundbedarfs ist kantonal unterschiedlich (siehe Checkliste unten). Viele Kantone halten sich an die Berechnungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos). Diese empfiehlt seit 1. Januar 2025 folgende monatliche Beträge:
- Einzelperson: 1061 Franken
- Zwei-Personen-Haushalt: 1624 Franken
- Drei-Personen-Haushalt: 1974 Franken
- Vier-Personen-Haushalt: 2271 Franken
- Fünf-Personen-Haushalt: 2568 Franken
- Für jede weitere Person: +216 Franken
Wohnkosten
Die Sozialhilfe übernimmt Miete und Nebenkosten zum ortsüblichen Preis. Wie hoch die entsprechende Grenze liegt, legen die Gemeinden in der Regel selber fest. Wenn jemand in einer zu teuren Wohnung lebt, kann die Behörde verlangen, dass die Person in eine günstigere Wohnung zieht.
Wer Sozialhilfe bezieht, hat keinen Anspruch, seine Eigentumswohnung oder sein Haus behalten zu dürfen. Wenn jemand im Eigenheim aber sehr günstig wohnen kann, ist ein Verkauf oft nicht sinnvoll. Das Sozialamt kann dann entscheiden, dass man das Wohneigentum behalten darf.
Die Behörde lässt in der Regel ein Grundpfand auf dem Wohneigentum errichten. So stellt sie sicher, dass bei einem späteren Verkauf die bezogenen Sozialhilfegelder zurückbezahlt werden.
Medizinische Grundversorgung
Die Sozialdienste bezahlen die Krankenkassenprämien für die Grundversicherung und Selbstbehalte sowie notwendige Zahnarztbesuche. Als notwendig gelten jährliche Zahnkontrollen, einfache, zweckmässige Zahnsanierungen und Dentalhygienebehandlungen. Kronen oder Brücken muss man meist selbst bezahlen.
Generell gilt: Wer Sozialhilfe bezieht, muss sich grundsätzlich nicht an medizinischen Kosten beteiligen.
Wie hoch ist der Grundbedarf in der Sozialhilfe in Ihrem Wohnkanton? Die Checkliste «So viel Geld gibt es in den Kantonen» zeigt es ausführlich für Beobachter-Abonnentinnen und -Abonnenten.
Werden ausserordentliche Kosten von der Sozialhilfe übernommen?
Situationsbedingte Leistungen
Der Grundbedarf muss für den allgemeinen Lebensunterhalt ausreichen. Wenn ausserordentliche Ausgaben anfallen, die zwingend notwendig sind, übernimmt die Sozialhilfe die Kosten. Einige Beispiele für solche situationsbedingte Leistungen:
- Kosten im Zusammenhang mit einer Krankheit oder einer Behinderung, etwa für Hilfsmittel wie Hörgeräte oder für Transportkosten.
- Kosten im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit, etwa für den Arbeitsweg, für Arbeitskleider oder die auswärtige Verpflegung.
- Kosten für die Integration und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel für eine Krippe oder eine Spielgruppe.
- Kosten, die durch einen Wegzug aus der Gemeinde entstehen.
Einkommensfreibetrag
Weil sich Arbeit lohnen soll, gewähren alle Kantone einen sogenannten Einkommensfreibetrag. Das ist ein Betrag, den erwerbstätige Sozialhilfebezüger zusätzlich aus ihrem Erwerbseinkommen erhalten. Wer neben der Sozialhilfe arbeitet, hat somit mehr Geld zur Verfügung.
Die Höhe des Betrags ist kantonal unterschiedlich geregelt und hängt primär von den Arbeitsprozenten ab. Eine zu hundert Prozent erwerbstätige Person, die Sozialhilfe bekommt, erhält monatlich 100 bis 600 Franken.
Muss man Sozialhilfe zurückzahlen?
Rückerstattungspflicht: Rechtmässig bezogene Sozialhilfegelder muss man grundsätzlich zurückerstatten – im Gegensatz zu den Leistungen der Sozialversicherungen (AHV, IV, EL). Dabei gibt es grosse kantonale Unterschiede. In einigen Kantonen muss man Sozialhilfegelder nur im Fall eines ausserordentlichen Vermögensanfalls – etwa einer Erbschaft oder eins Lottogewinns – zurückzahlen. In den meisten Kantonen ist eine Rückerstattung auch aus einem späteren Erwerbseinkommen möglich beziehungsweise klar vorgesehen. Unrechtmässig bezogene Sozialhilfegelder muss man in allen Kantonen zurückzahlen.
Verjährung: Die Pflicht, Sozialhilfegelder zurückzuzahlen, bleibt nicht in alle Ewigkeit bestehen, sie verjährt früher oder später. Graubünden kennt eine Verjährung allerdings erst seit Anfang 2016, vorher war die Rückerstattungspflicht unverjährbar. In anderen Kantonen verjährt sie nach 10, 15 oder gar erst nach 20 Jahren – je nach Situation also eine lange Zeit, in der man diese Schulden mit sich schleppen muss.
Wer Sozialhilfe beantragt, hat sowohl Rechte als auch Pflichten. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erhalten darüber Auskunft, ob Sozialhilfe später zurückerstattet werden muss. Musterbriefe liefern zudem Unterstützung, wenn Beschwerde gegen einen Entscheid eingelegt wird.
Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.
Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.