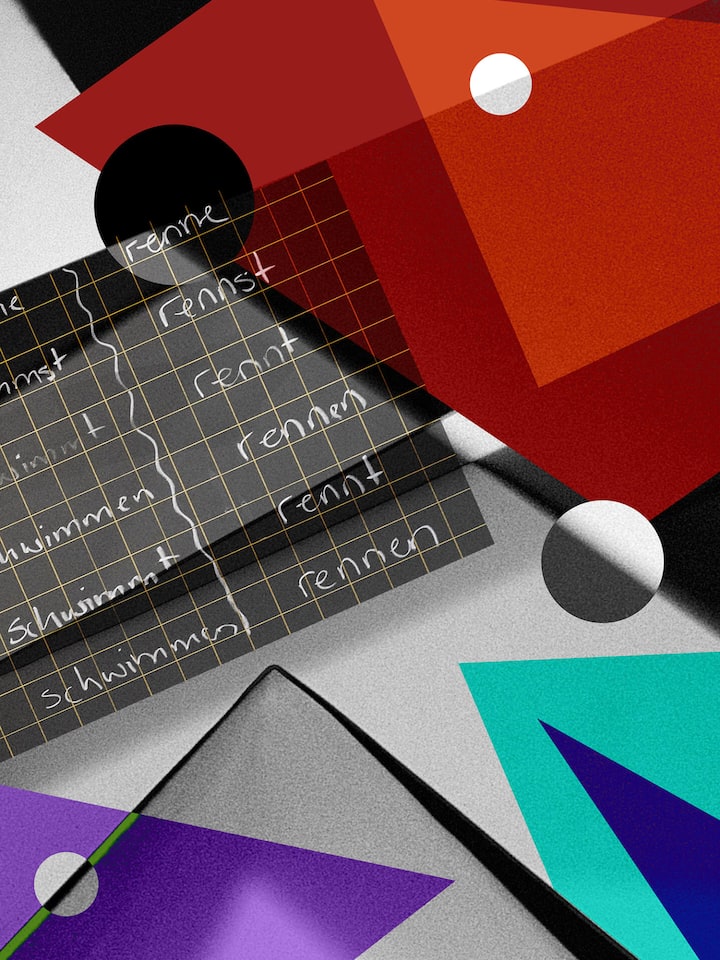Die Schule verlangt eine Abklärung für mein Kind – was jetzt?
Viele Eltern sind verunsichert, wenn die Schule ihnen empfiehlt, das Kind auf ADHS oder Autismus abklären zu lassen. Müssen sie dem Wunsch nachkommen? Sechs Fragen und Antworten.

Veröffentlicht am 23. Oktober 2025 - 15:21 Uhr

Ist eine Abklärung immer nötig, wenn ein Kind aus der Reihe tanzt?
Immer mehr Kinder fühlen sich vom Schulalltag überfordert. Sie kämpfen mit Prüfungsstress, Hausaufgaben und haben Mühe, sich in den Schulbetrieb zu integrieren. In Abklärungen werden vermehrt Diagnosen wie ADHS oder Autismus festgestellt. Der Bedarf an Unterstützung ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen. «Um mindestens 30 Prozent», schätzte Michael von Rhein, leitender Entwicklungspädiater am Kinderspital Zürich, gegenüber dem Newsportal Watson.
Über die Gründe können die Fachpersonen im Artikel nur mutmassen. Die Früherkennung funktioniere besser, besondere Bedürfnisse fallen schneller auf. Die Corona-Pandemie sei eine prägende Erfahrung gewesen. Viele Kinder seien zudem überbehütet, weniger draussen und öfter vor den Bildschirmen.
Die Folge: Lehrpersonen sind am Limit, schulpsychologische Dienste (SPD) überlastet. Bis ein Kind einen Termin für die Abklärung bekommt, vergehen oft Monate.
Für viele Eltern beginnt die Verunsicherung aber schon vor der Diagnose; meist mit einem Satz der Lehrperson: «Sie sollten Ihr Kind vielleicht abklären lassen.»
Was gehört zur elterlichen Pflicht? Und wer hat das letzte Wort? Beobachter-Expertin Daniela Bleiker Patt beantwortet die drängendsten Fragen.
Daniela Bleiker Patt, die Lehrperson empfiehlt eine schulpsychologische Abklärung. Müssen Eltern ihr Folge leisten?
Die Schule darf das Kind nicht für eine Abklärung anmelden, wenn die Eltern dagegen sind. Sie hat aber die Möglichkeit, eine Gefährdungsmeldung an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die Kesb, zu machen. Diese wiederum kann eine Abklärung auch gegen den Willen der Eltern veranlassen, wenn sie zum Wohl des Kindes notwendig erscheint.
Haben Eltern das Recht, beim Gespräch dabei zu sein oder den Bericht einzusehen?
Die Eltern werden in den Prozess einbezogen. Die Abklärung umfasst oft mehrere Termine, einzelne können auch ohne Eltern stattfinden – etwa wenn das Verhalten in der Schule beobachtet wird. Abschliessend schreibt der SPD einen Bericht mit empfohlenen Massnahmen für die Schule. Die Eltern erhalten eine Kopie.
«Der Kanton und die Schulgemeinde übernehmen die Kosten für die Abklärung und allfällige Massnahmen.»
Wer entscheidet, was nach der Abklärung passiert?
Der SPD empfiehlt im Bericht geeignete Massnahmen und bespricht diese mit der Schule und den Eltern. Im Fokus der Massnahmen stehen die Unterstützung in der Schule und die Verbesserung der Lernumgebung. Es geht nicht darum, Krankheiten zu behandeln – der SPD ist aber mit Fachpersonen vernetzt und kann beispielsweise einen Besuch beim Kinderpsychiater empfehlen.
Wer übernimmt die Kosten für die Abklärung und allfällige Massnahmen?
Der Kanton und die Schulgemeinden. Auch schulische Unterstützungsmassnahmen müssen die Eltern nicht bezahlen, wenn der SPD diese empfohlen hat.
«Ein Lehrbetrieb hat keinen Zugriff auf die Daten des schulpsychologischen Dienstes.»
Eltern haben womöglich Angst, dass ihr Kind als dumm abgestempelt oder gehänselt wird, wenn die Abklärung zum Beispiel eine Lernschwäche ergibt. Ist diese Sorge berechtigt?
Die Sorge ist verständlich. Ein Kind, das ohne Unterstützung ständig scheitert oder aneckt, kann ebenso Zielscheibe sein und darunter leiden. Die Abklärung soll genau das verhindern. Sie gibt dem Kind und den Lehrpersonen Werkzeuge an die Hand, um den Schulalltag besser zu meistern. Das stärkt das Selbstvertrauen. Eine Lehrperson, die über die Hintergründe Bescheid weiss, kann zudem viel besser auf die Klassendynamik einwirken und Mobbing proaktiv begegnen.
Welche Folgen hat ein SPD-Bericht, zum Beispiel für die spätere Stellensuche?
Eine Abklärung ist nötig, damit schulische Unterstützung bezahlt wird. SPD-Mitarbeitende unterliegen dem Amtsgeheimnis und der Schweigepflicht. Schulen dürfen persönliche Daten speichern, etwa zum Lernverhalten oder zu sonderpädagogischen Massnahmen. Beim Schulwechsel werden zwar einige Daten weitergegeben, aber nur während der Volksschulzeit. Ein Lehrbetrieb hat keinen Zugriff darauf.