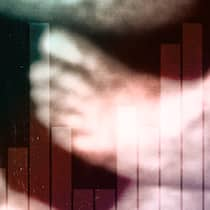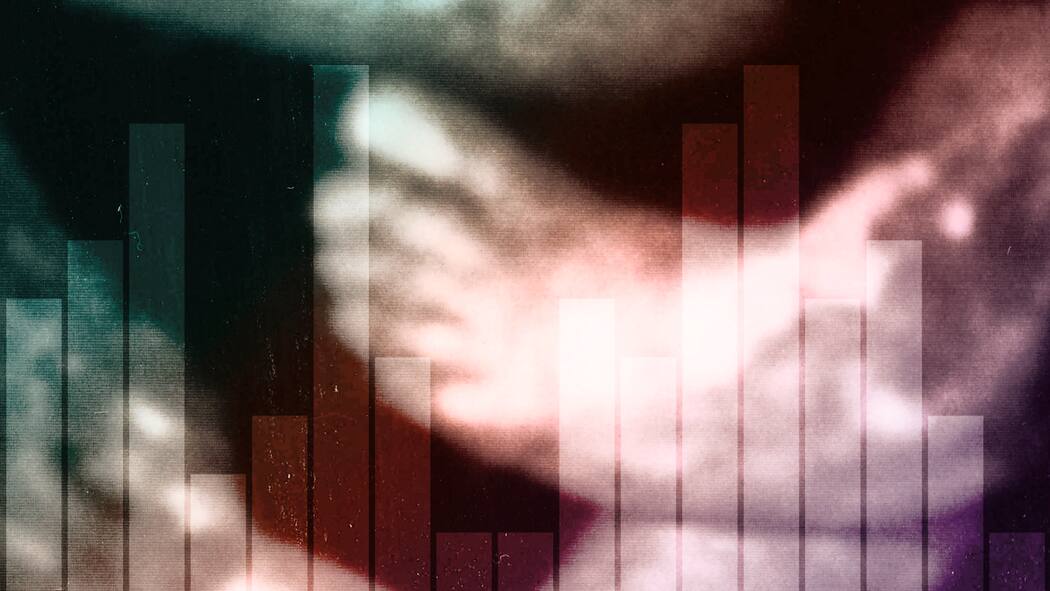Eizellen einfrieren soll günstiger werden
Die Zahl der Schweizer Frauen, die ihre Eizellen konservieren lassen, hat sich seit 2019 vervielfacht. Ein Behandlungszyklus kostet 5500 Franken und mehr.

Veröffentlicht am 27. Mai 2025 - 17:48 Uhr

Eizellen werden bei minus 196 Grad schockgefroren.
Eizellen bei minus 196 Grad Celsius schockgefrieren und für eine spätere Befruchtung aufbewahren – die Zahl der Schweizer Frauen, die sich für dieses sogenannte Social Freezing entscheiden, steigt rapide an. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) haben im Jahr 2023 2551 Frauen dieses Verfahren in Anspruch genommen – eine Verdreifachung gegenüber 2019.
Zuerst die Karriere
Immer mehr Frauen in der Schweiz konzentrieren sich zuerst auf ihre beruflichen Ziele und kümmern sich dann um die Familienplanung. Das zeigt eine Studie der Universität St. Gallen. Ein Grund dafür ist, dass fast die Hälfte aller Beförderungen auf die Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen entfällt. Nach dem 40. Lebensjahr sinken die Chancen auf eine Führungsposition drastisch.
Wobei die Wahrscheinlichkeit bei Frauen nochmals deutlich geringer ist als bei Männern. Bei 41- bis 50-Jährigen gehen nur noch 10 Prozent der Beförderungen in Führungspositionen an Frauen. Das Durchschnittsalter von Frauen, die ihr erstes Kind gebären, liegt in der Schweiz bei 31,2 Jahren. Das ist eineinhalb Jahre älter als der europäische Durchschnitt.
Nationalrätin findet: Social Freezing soll günstiger werden
SP-Nationalrätin Farah Rumy will Social Freezing breiter zugänglich machen. Im Mai hat sie eine Interpellation zum Thema eingereicht und fordert vom Bundesrat Antworten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Kosten des Einfrierens von Eizellen.
Am Universitätsspital Zürich kostet ein Behandlungszyklus zwischen 4500 und 5500 Franken, zuzüglich 700 Franken für das Einfrieren und einer jährlichen Aufbewahrungsgebühr von 400 Franken. Krankenkassen übernehmen die Kosten nur, wenn es medizinisch notwendig ist – beispielsweise vor einer Chemotherapie.
Das Durchschnittsalter der Frauen, die sich für Social Freezing entscheiden, liegt bei der Kinderwunschklinik Cada in Zürich bei 34 Jahren. Etwa 30 Prozent der Kundinnen nutzen die gefrorenen Eizellen später. Die Erfolgsquote für eine Lebendgeburt liegt bei etwa 20 bis 30 Prozent pro Zyklus und sinkt bei Frauen über 40. In der Schweiz dürfen Eizellen maximal zehn Jahre gelagert werden.
Firmen übernehmen die Kosten
In den USA übernehmen grosse Firmen wie Apple und Facebook bereits seit 2014 die Kosten für das Einfrieren von Eizellen. Als erste Firma in der Schweiz unterstützt das Pharma- und Technologieunternehmen Merck seine Mitarbeitenden seit Oktober 2023 finanziell bei Kinderwunschbehandlungen.
Farah Rumy lobt die Firmen zwar, die ihre Angestellten in der Familienplanung unterstützen, sieht darin aber noch keinen Vorteil für Paare aus tiefen Einkommensschichten. Sie plant weitere Vorstösse im Rahmen der Überarbeitung des Fortpflanzungsmedizingesetzes, die der Bundesrat am 29. Januar 2025 beschlossen hat.
Mehr Transparenz und eine Preisobergrenze
Die Nationalrätin aus dem Kanton Solothurn fordert mehr Transparenz bei der Kostenberechnung und die Einführung einer Preisobergrenze für Behandlungen. «Das Recht auf eine Familie und auf Kinder darf einfach nicht vom Portemonnaie abhängig sein», findet sie. Ihrer Meinung nach wären einkommensabhängige Preise die beste Lösung. Dafür sieht sie in der Schweiz allerdings wenig Chancen.
- Kinderwunschklinik Cada: «Social Freezing steigt weltweit um 60% (30+ Social Freezing Statistiken)»
- Bundesamt für Gesundheit (BAG): «Konservierung von Keimzellen (Eigenvorsorge und Spende)»
- Universität St. Gallen (Download, PDF): «Hätte ich nur Bescheid gewusst: Familienplanung und Fertilität in der Schweiz»
- Technologie- und Pharmaunternehmen Merck: «Merck startet Programm zur Unterstützung von Mitarbeitenden mit Kinderwunsch»
- Telefongespräch mit SP-Nationalrätin Farah Rumy