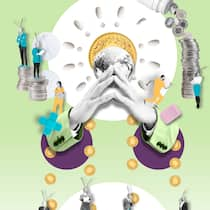Unser Gesundheitssystem ist ausser Kontrolle
Die Bilanz nach einem Jahr Prämienticker-Berichterstattung ist ernüchternd. Wir zeigen acht Probleme, die dringend gelöst werden müssen.

Veröffentlicht am 25. September 2025 - 08:37 Uhr
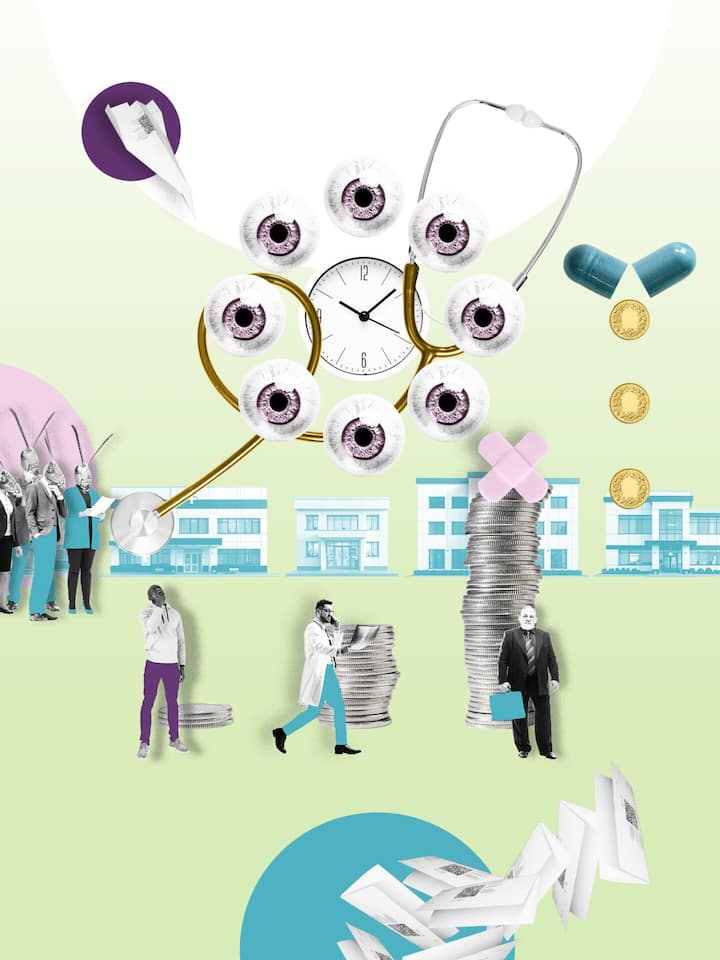
Fehlerhafte Rechnungen, Einfluss von Investoren und mangelnde Transparenz – alles zulasten der Prämienzahlenden.
Martina Graber kann es kaum glauben. Obwohl sie vor einem Jahr ihre Hausarztpraxis gewechselt hat, schickt ihr die alte Praxis immer wieder Rechnungen. Es geht um kleine Beträge von 10 bis 70 Franken. Aber wofür, ist ihr völlig unklar. Mal ist von «Aktenstudium» die Rede, mal von «Instruktion von Selbstmessungen». Eine bereits bezahlte Salbe wurde nochmals verrechnet.
Graber – die in Wirklichkeit anders heisst – will sich Hilfe und Beratung holen. Sie kontaktiert die Praxisleitung. Doch die antwortet nicht. Die Krankenkasse erklärt sich für nicht zuständig. Die Rechtsschutzversicherung sagt, die Beträge seien zu klein, um ein Verfahren zu eröffnen. Der Kantonsarzt schliesslich empfiehlt – sich an die Krankenkasse zu wenden. «Überall lief ich auf. Ich war wütend und fühlte mich ohnmächtig», sagt sie zum Beobachter.
Problem 1: Abrechnungswesen
Damit ist sie nicht allein. Rund 200 Leserinnen und Leser haben sich dieses Jahr im Rahmen des Projekts Prämienticker beim Beobachter gemeldet. Viele berichten von fragwürdigen Rechnungen, unverständlichen Abkürzungen und davon, bei Reklamationen abgewimmelt zu werden.
Dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, belegen Zahlen. Jährlich werden im ambulanten Bereich rund eine Milliarde Franken unzulässig verrechnet – das sind laut dem Beratungsunternehmen Blacklight Analytics über zehn Prozent aller vergüteten ambulanten Leistungen.
«Das ist nichts anderes als Betrug an Patienten und Kassen.»
Sebastian Schnyder, pensionierter Chirurg
Sogar Ärzte kritisieren das System. Etwa der pensionierte Chirurg Sebastian Schnyder. «Ich hatte relativ viele Gesundheitsprobleme im vergangenen Jahr – und erhielt eigentlich fast nur falsche Abrechnungen.» In sechs Rechnungen habe er 19 fragwürdige Optimierungen sowie Positionen gefunden, die gar nicht geleistet worden seien. «Das ist nichts anderes als Betrug an Patienten und Kassen.»
Schnyder hat als Arzt das Fachwissen, Rechnungen zu prüfen. Für die meisten Patienten jedoch sind sie ein Buch mit sieben Siegeln, gespickt mit Tarifcodes und Fachbegriffen. Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider will genau hier ansetzen: «Wir brauchen verständliche Rechnungen, damit Patientinnen und Patienten die Kassen bei der Kontrolle unterstützen können.»
Gleichzeitig betont sie im Gespräch mit dem Beobachter, wir sollen dem System vertrauen. Doch die Frage stellt sich: Ist das System tatsächlich vertrauenswürdig?
Problem 2: Privatinvestoren drängen in den Markt
Fakt ist: Immer mehr private Investoren drängen in den Schweizer Gesundheitsmarkt. Besonders betroffen sind lukrative Fachrichtungen wie Radiologie, Urologie oder Orthopädie. In der Radiologie etwa schätzt die Fachgesellschaft, dass inzwischen 40 Prozent der Praxen von Investoren betrieben werden.
Vom Investorendruck stark betroffen ist auch die Augenheilkunde. Eine Augenärztin erinnert sich an ihre Zeit in einer grossen Augenarztkette: «Ich musste Zwei-Minuten-Medizin machen und so viele Patienten wie möglich durchschleusen. Gute Medizin konnte ich so nicht bieten.»
Die betroffene Kette weist den Vorwurf zurück. Doch der Fall zeigt, wie sich Investorenstrukturen auf die tägliche Versorgung auswirken können. Der Renditedruck kann zu höheren Kosten führen, weil mehr – und möglicherweise unnötig – behandelt wird. Dies bei sinkender Qualität, weil weniger Zeit zur Verfügung steht.
Hellhörig geworden ist inzwischen auch das Bundesamt für Gesundheit. Im April hat das Amt eine Studie in Auftrag gegeben, die das Ausmass des Investorenphänomens ermitteln soll. Die Ergebnisse werden für 2026 erwartet.
Problem 3: Interessenkonflikte durch Pharmazahlungen
Pharmafirmen zahlen Ärzten oft sehr viel Geld – manchmal so viel, wie sie normalerweise verdienen. Der Beobachter hat Fälle gefunden, wo Ärztinnen und Ärzte sechsstellige Beträge an Spesen und Honoraren von Pharmakonzernen erhalten. Das schafft ein Problem: Ärzte sollen eigentlich nur entscheiden, was medizinisch nötig ist. Aber wenn sie viel Geld von Pharmafirmen erhalten, könnte das ihre Entscheidungen beeinflussen.
Problem 4: Fehlende Sparanreize
Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Ärzte, Spitäler und Kassen haben in Tarifverhandlungen kaum einen Anreiz, sparsam mit den Prämiengeldern umzugehen, heisst es in einer BAG-Studie von Swiss-Economics. Ärzte wollen hohe Tarife. «Demgegenüber dürften die Anreize der Versicherer, sich für tiefe Tarife einzusetzen, limitiert sein», so die Studienautoren. In der Grundversicherung bestehe ein Gewinnverbot, moderate Tarife würden den Krankenkassen keinen direkten Nutzen bringen.
Der Versichererverband Prioswiss widerspricht: Kassen hätten ein Interesse an Wirtschaftlichkeit, um tiefe Prämien anbieten zu können. Man kontrolliere jährlich 130 Millionen Rechnungen und spare so 3,5 Milliarden Franken.
Problem 5: Es wird sehr gut verdient
Für ihre Anstrengungen lassen sich Kassenchefs fürstlich vergüten: 2023 verdienten sieben von zehn CEOs mehr als 700’000 Franken, Spitzenreiter war Sanitas-Chef Andreas Schönenberger mit 955’176 Franken. Auch bestimmte Fachärzte verdienen sehr gut. So liegt gemäss Bundesamt für Statistik das mittlere Jahreseinkommen von Magen-Darm-Spezialisten bei 448’000 Franken und jenes von Augenärzten bei 342’000 Franken.
Der Durchschnitt niedergelassener Ärztinnen und Ärzte liegt bei 260’000 Franken – dreimal so viel wie der Durchschnitt der Arbeitnehmenden.
Kostentreibend wirkt auch die Intransparenz bei Medikamenten und Implantaten. Der Preisüberwacher fand heraus: Dasselbe Herzschrittmachermodell kostet in einem Spital 1200 Franken, in einem anderen 5400 Franken. Knieprothesen sind mal für 1000, mal für 5700 Franken zu haben. Niemand weiss, was die Konkurrenz bezahlt, die Hersteller diktieren die Preise. Auch bei Medikamenten ist die Schweiz Spitzenreiterin. Generika kosten im Ausland fast die Hälfte weniger.
Problem 6: Sparpotenzial wird nicht genutzt
Laut einer BAG-Studie könnten bis zu 8,4 Milliarden Franken jährlich eingespart werden – fast 1000 Franken pro Versicherten. Ohne dass Patienten schlechter versorgt würden. Denn die Einsparungen betreffen vor allem überhöhte Preise, unnötige Leistungen und mangelnde Transparenz.
Problem 7: Es fehlen Kontrollinstanzen
Doch im Gesundheitswesen fehlen effektive Kontrollinstanzen. Gemäss einer weiteren BAG-Auftragsstudie trägt auch das dazu bei, dass die Kosten stetig steigen.
Patientin Martina Graber hat die zehn Kleinstrechnungen schliesslich resigniert bezahlt – sie wollte keinen Ärger, und hat ihre alte Hausarztpraxis nicht wieder aufgesucht. Ihr Fazit: «Es gibt offenbar keinen Schutz vor solchen fragwürdigen Abrechnungen.»
Problem 8: Zu wenig Mitsprache
Ihr Fall zeigt im Kleinen, was im Grossen falsch läuft: ein Gesundheitswesen, in dem sich zu viele am stetig wachsenden Prämienkuchen bedienen – und in dem Patientinnen und Patienten zwar bezahlen, aber nicht mitreden dürfen.
Der Beobachter möchte das ändern. Er lanciert deshalb eine Petition, die mehr Mitsprache für die Prämienzahlenden fordert. Und er lädt die Leserinnen und Leser sowie ein ausgesuchtes Fachpublikum ein, an einer Tagung Ende Oktober gemeinsam über Lösungen für das Kostenproblem zu diskutieren.
- Infras und Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Bericht: Effizienzpotenzial bei KVG-pflichtigen Leistungen
- Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Preisüberwacher: Orthopädische und kardiale Implantate: grosse Preisunterschiede zwischen Schweizer Spitälern (Kapitel 1.1 des Newsletters, zum Download)
- Medtech Europe: Facts & Figures 2025, Zahlen zum Implantatemarkt, auf Englisch
- Santésuisse (heute Prio Swiss): Auslandpreisvergleich Medikamente 2023 Schlussfolgerungen
- Eidgenössische Finanzkontrolle: Evaluation der Massnahmen zur Förderung oder Begrenzung der Anzahl chirurgischer Eingriffe
- Swiss Economics, Schlussbericht: Regulierungsfolgenabschätzung zu einer Zielvorgabe für die Kostenentwicklung in der OKP (Pdf zum Download)