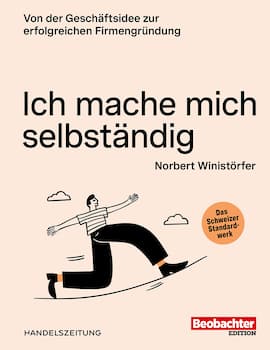Gelte ich als selbständig oder angestellt?
Selbständige haben weniger Rechte als Angestellte. Doch so mancher freie Mitarbeiter ist faktisch eigentlich angestellt.

Veröffentlicht am 14. März 2024 - 11:33 Uhr

Freelancer sind gegenüber Festangestellten in Bezug auf die Sozialversicherungsbeiträgen schlechter gestellt.
Eigentlich tut Günther Meili (Name geändert) das Gleiche wie sein Bürokollege: Er telefoniert mit Kunden, verkauft Werbeflächen in Zeitschriften und auf Plakatwänden und koordiniert den Druck. Dazwischen trifft er seine Kollegen auf einen Schwatz im Kaffeeraum, und wenn er Geburtstag hat, bringt er Gipfeli mit. Aber: Sein Pultnachbar hat einen Arbeitsvertrag, und Meili ist als selbständiger Projektmitarbeiter tätig. Doch wo genau liegt der Unterschied?
Ob ein Arbeitsvertrag vorliegt oder nicht, ist nicht immer einfach zu beurteilen (siehe weiter unten «Freelancer sind ein Spezialfall»). Für Betroffene ist die Antwort aber von grosser Tragweite.
Die AHV entscheidet
Sicher ist: Wie die Parteien die Zusammenarbeit bezeichnen, ist nicht massgebend. Es kommt also nicht darauf an, dass Günther Meilis Vertrag fett mit «Dienstleistungsvertrag» überschrieben ist oder darin festgehalten wird, dass er «für die notwendigen Versicherungen selber aufkommen muss». Ein paar Buchstaben im Vertrag reichen nicht dazu aus, dass sich ein Arbeitgeber seiner Pflichten entledigen kann.
Ob man als Selbständiger oder als Angestellter gilt, entscheidet in einem ersten Schritt die AHV-Ausgleichskasse. Dort meldet sich an, wer eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen möchte. Die AHV-Ausgleichskasse entscheidet aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse. Wenn der Betroffene in die Arbeitsorganisation einer Firma eingegliedert ist, geht die AHV regelmässig nicht von einer Selbständigkeit aus.
Als sich Meili bei der Ausgleichskasse anmeldete, war er noch flexibler, konnte sich die Arbeitszeit frei einteilen und warb Kunden meist von zu Hause oder von unterwegs an. Das war ihm recht so, denn er arbeitet auch noch für andere Auftraggeber.
Mit der Zeit wurden ihm aber beim jetzigen Arbeitgeber zusätzliche Aufgaben übertragen, die er vor Ort erledigen muss. Er ist nun an gewisse Präsenzzeiten gebunden und belegt einen eigenen Arbeitsplatz. Für andere Auftraggeber ist er nicht mehr tätig.
Anspruch auf mehr Versicherungen
Schritt für Schritt ist Meili so zum Scheinselbständigen geworden. Das heisst: Er leistet seine Arbeit auf selbständiger Basis, obwohl eigentlich alle Voraussetzungen für einen Arbeitsvertrag gegeben sind. Damit verzichtet er auf viele Sicherheiten.
Arbeitnehmer sind von Gesetzes wegen sozialversichert – AHV/IV/ALV, Pensionskasse, Unfallversicherung. Bei Selbständigen ist das anders. Obligatorisch sind sie nur bei der AHV/IV/EO versichert. Sie haben also keine staatliche Arbeitslosenversicherung und keine obligatorische berufliche Vorsorge. Wenn sie verunfallen oder krank werden, kommt die Krankenkasse zwar für die Heilungskosten auf, nicht aber für den Lohnausfall.
Streitfall 1: Chauffeur fährt mit seinem eigenen Lastwagen
Selbständige müssen sich also selber absichern. Dazu können sie sich freiwillig bei einer Pensionskasse versichern oder eine Lohnausfallversicherung abschliessen. Beides ist allerdings teuer.
Auch sonst ist Meili gegenüber seinen Bürokollegen benachteiligt. Wenn es viel zu tun gibt, arbeitet er von früh bis spät. Auf diese Weise sorgt er für magere Zeiten vor, wenn etwa die Auftragslage schwach ist, er schon vor der Mittagspause nach Hause geschickt wird oder gar nicht erst zur Arbeit erscheinen muss.
Diese Monate reissen jeweils ein grosses Loch in sein Budget. Wie damals, als er zwei Wochen mit einer schweren Grippe im Bett lag. Bezahlt wird Meili nämlich nach Aufwand, also nur für die Stunden, die er effektiv geleistet hat. So kommt es auch, dass er sich im vergangenen Jahr nur zehn freie Tage gegönnt hat. Mehr lag einfach nicht drin.
Beobachter-Abonnentinnen und -Abonnenten erfahren in der Mustervorlage «Freier Mitarbeiter», wie man arbeitsvertragliche Punkte wie die Sozialversicherung, Lohnfortzahlung bei Krankheit und die Entlöhnung regelt und wie man alternativ einen Vertrag aufsetzt, wenn die Selbständigkeit durch die AHV nicht anerkannt wird.
Unfreiwillig zum Selbständigen
Das schwankende Einkommen belastet Meili. Nach einem Jahr fühlt er sich ausgebrannt und ungerecht behandelt. Immerhin beziehen seine Bürokollegen vier Wochen bezahlte Ferien, können ihre Überstunden kompensieren und bekommen ihren Lohn auch, wenn sie krank sind.
Die Scheinselbständigkeit kommt aber nicht immer schleichend wie bei Meili. Sie kann auch plötzlich eintreten, etwa wenn der Arbeitgeber Geld sparen will und einen Mitarbeiter einfach zum Selbständigen erklärt, der für seine Dienste von heute auf morgen Rechnung stellen muss. Betroffen sind oft Ältere, die man nach einer Entlassung unregelmässig und zu schlechteren Bedingungen als Freie weiterbeschäftigt.
Wer zweifelt, ob er noch Dienstleister oder bereits Arbeitnehmer geworden ist, sollte seinen Status abklären. Das kann man kostenlos bei den kantonalen Ausgleichskassen.
Streitfall 2: Coiffeuse mietet einen Stuhl in einem Salon
Falls die Ausgleichskasse eine Scheinselbständigkeit feststellt, fordert sie die ausstehenden Sozialabgaben vom Arbeitgeber nach. Dieser wiederum kann den Arbeitnehmerbeitrag vom Arbeitnehmer zurückverlangen – und zwar innert eines Jahres ab Mitteilung über die Beitragspflicht.
Und: Wer vor der AHV-Behörde als unselbständig gilt, ist es auch gegenüber den Pensionskassen. Der Arbeitgeber muss ihn also bei seiner PK versichern und Beiträge nachzahlen. Wenn er die Sozialversicherungsbeiträge absichtlich nicht oder falsch abrechnet, macht er sich strafbar.
In vielen Fällen führt bereits ein Gespräch mit dem Chef zum Ziel. Man sollte seinen Standpunkt aber stets auch schriftlich darlegen. Bei Uneinigkeit oder wenn die Zusammenarbeit danach gar plötzlich beendet wird, kann man seine Ansprüche auf dem Gerichtsweg geltend machen. Die Schlichtungsbehörden respektive Gerichte klären dann ab, ob man in einem Arbeitsverhältnis steht oder nicht. Im Zweifelsfall gehen die Gerichte in der Regel von einem Arbeitsverhältnis aus.
Streitfall 3: Yogalehrer gibt Lektionen im Fitnessstudio
Entschädigung bei Rachekündigung
Übrigens: Wer als Arbeitnehmer gilt und plötzlich auf die Strasse gestellt wird, kann allenfalls auch eine Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung geltend machen. Missbräuchlich ist eine Kündigung immer dann, wenn sich der Arbeitnehmer zuvor auf anständige Weise für seine Rechte gewehrt hat (man spricht hier von einer sogenannten Rachekündigung). Die Entschädigung beträgt bis zu sechs Monatslöhne.
Auch Günther Meili suchte das Gespräch – und fand eine Lösung. Jetzt arbeitet er nicht mehr als Dienstleister, sondern ganz offiziell als Arbeitnehmer. Zusätzlich zu den vier Wochen Ferien gemäss Arbeitsvertrag erhält er fürs nächste Jahr zwei weitere Ferienwochen zugesagt. Auf weitergehende Forderungen hat Meili verzichtet. Dem Frieden zuliebe.
Freelancer sind ein Spezialfall
Freie Mitarbeiter oder Freelancer sind weniger eng in den Betrieb eingebunden als Festangestellte. Sie haben in der Regel grössere Freiheiten in der Arbeitsgestaltung und werden oft nur von Fall zu Fall beschäftigt.
Eine gesetzliche Definition der freien Mitarbeit existiert nicht. Das Bundesgericht hielt fest, dass freie Mitarbeiter weder klar zur Definition Arbeitnehmer noch klar zur Definition Selbständiger passen. Und so muss man jeden Einzelfall anhand der konkreten Umstände untersuchen.
Übrigens: Auch Mischformen sind denkbar. So kann man zwar selbständig tätig sein, aber dennoch einzelne arbeitsvertragliche Elemente vereinbaren wie zum Beispiel bezahlte Ferien oder Kündigungsfristen.